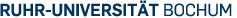Aktuelle Mitteilungen
Teil der Lösung – Plädoyer für ein bedingungsloses Grundeinkommen
Veröffentlicht am 17. Februar 2015
von Kim Uridat
Die Debatte um das Grundeinkommen ist eine polarisierende und eine teilweise hitzig geführte, die sich häufig in die Pro- und Contra-Position teilt und manchmal auch darin verliert. Der Frage, wie ein Grundeinkommen aussehen könnte und welche Vorteile dies haben kann, gehen die Herausgeber Ronald Blaschke und Werner Ratz nach und untersuchen in ihrem Buch die »Sicherheit des Einkommens« und wie entscheidend wirtschaftliche Zusammenhänge gerade in Krisenzeiten sind. Das Grundeinkommen, so stellen es die Autoren vor, muss bestimmte Bedingungen erfüllen, sie vermeiden dabei trotz ihres Standpunktes plakative Polarisierungen, auch wenn sie sich von Arbeiten wie Irrweg Grundeinkommen von Heiner Flassbeck, Friederike Spiecker, Volker Meinhardt und Dieter Vesper abgrenzen wollen. Das Plädoyer für ein Grundeinkommen besteht aus 12 Essays, die unterschiedliche Aspekte des Themas beleuchten. Darunter fällt die Forderung, das Grundeinkommen durch eine Volksabstimmung einzuführen, und natürlich die entscheidende Frage nach der Finanzierung. Blaschke stellt in seinem Essay »Irrweg Marktmensch« vor, welches Gesellschaftsbild unsere heutige Welt prägt, die von einer starken und »dominante[n] marktradikale[n]« Ausrichtung geprägt ist, die das Wirtschafts-, Arbeits- und gesellschaftliche Leben in starker Weise beeinflusst. Bei der Vorstellung, die in Blaschkes Text thematisiert wird, handelt es sich um ein Modell, das nicht von Leistung abhängt, wie es sonst im Wirtschaftsleben zum Großteil der Fall ist. Antje Schrupp greift in ihrem Essay »Erkennen was notwendig ist« die Tatsache auf, dass eine häufige kritische Haltung gegenüber dem Grundeinkommen genau aus der Negierung oder Abkopplung des Leistungsaspektes resultiert und sie sich durchaus darüber bewusst sei, dass darin auch ein Knackpunkt liegen kann. Leistung ist ein omnipräsenter Begriff in allen Lebenslagen, also auch bei der Frage des Grundeinkommens. Die einzelnen Essays sind vielschichtig, detailliert und stellen Fragen zum Kapitalismus, zur Arbeit und Arbeitsleistung und zur Gesellschaft. Die Frage nach Bürgergeld oder Grundeinkommen bleibt ein strittiges Thema, aber unabhängig davon, ob man sich für oder gegen ein solches Modell entscheidet, sollte man die Papptafeln mit »Ich bin dafür« oder »Ich bin dagegen« erst einmal entsorgen, denn das Plädoyer von Blaschke und Ratz liefert Argumente für ein Grundeinkommen, bringt den Leser allerdings ebenso dazu, sich selbst kritische Fragen zu stellen und eine eigene Meinung zur der Frage des Grundeinkommens zu bilden. Auch wenn das Thema in diesem Buch sehr komplex dargestellt wird, arbeiten auch die einzelnen Autoren kritische Punkte heraus, sodass sich das Buch in keiner Weise damit zufrieden gibt, eine simple Streitschrift zu sein. Es liefert keinesfalls einfache Antworten auf eine Frage, die nicht nur politisch, sondern vor allem gesellschaftlich relevant ist, und es gibt wertvolle Denkanstöße zum Weiterlesen.
Ronald Blaschke, Werner Rätz (Hrsg.): Teil der Lösung. Plädoyer für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Rotpunkt, 2013, 17,90 €.
Stillstand ist der Tod: In Thomas Lehrs Roman "42" steht die Zeit still – und quält den Protagonisten
Veröffentlicht am 8. Februar 2015
von Christian Wobig
Was würde man tun, wenn man der Einzige wäre, der im Dornröschenschloss wachte, zwischen all den eingeschlafenen, erstarrten Figuren, die die stillstehende Zeit mitten in der Bewegung hat innehalten lassen? Würde man nicht denken, sie alle stünden da und harrten der Sekunde, in der nach hundertjährigem Schlaf alles wieder, wie von einer Sekunde auf die andere, erwachte, seine Bewegung fortsetzte? Hoffte man dies nicht gar? Was aber, wenn man bereits fünf Jahre in der stillstehenden Zeit umherwanderte, in dem Bewusstsein, dass es nur wenige nicht erstarrte Menschen gibt, Chronifizierte, wie man selbst? Dürfte man dann zugreifen und sich nehmen, was man wollte? Und was würde passieren, würde die Welt sich doch plötzlich eines Tages weiterdrehen?
Vor diese Fragen sieht sich in Thomas Lehrs Roman »42« eine Gruppe von Besuchern des CERN im schweizerischen Genf gestellt, als sie nach einer Besichtigung des unterirdischen DELPHI-Detektors wieder an die Oberfläche zurückkehrt: Flugzeuge stehen wie festgeklebt am Himmel, Vögel verharren regungslos in der Luft, Menschen stehen wie zu Salzsäulen erstarrt in der letzten Pose, die sie eingenommen haben, bevor es 12:47:42 Uhr wurde. Die »Chronifizierten«, wie die Überlebenden sich nennen, umgibt eine Blase, innerhalb derer die Zeit noch normal vergeht. Dadurch können sie im erstarrten Wasser schwimmen in einer zufällig gegen Mittag einlaufen gelassenen Badewanne baden, oder das immer gerade auf den Tisch gestellte und heiße Mittagessen erstarrter Menschen essen. Erstarrte, die in den Einflussbereich der »Chronosphäre« eines Chronifizierten gelangen, werden aus ihrem Zustand befreit, kommen allerdings nicht zu Bewusstsein und brechen mit einem Stöhnen in sich zusammen.
Wie alle Chronifizierten zieht sich Adrian Haffner, Wissenschaftsjournalist und Hauptfigur des Romans, in die Einsamkeit zwischen den starren Menschen zurück und wandert auf der Suche nach seiner Frau wochenlang durch Europa. Auf seiner Wanderschaft durch die gefrorene Welt durchläuft er die fünf Phasen des Niedergangs, der alle Chronifizierten erfasst: Schock, Orientierung, Missbrauch, Depression, Fanatismus. In Berlin stößt er schließlich auf einen Hinweis, dass seine Frau nicht allein in den Urlaub an die Ostseeküste gefahren ist, sondern ihn vielmehr schon länger betrügt. Den Nebenbuhler, den er schließlich in Florenz immer gerade in flagranti mit seiner Frau erwischt, drapiert er so auf dem Fensterbrett des Hotelzimmers, dass er, so die Welt irgendwann dornröschengleich aufwachen sollte, rückwärts hinabstürzt auf den Asphalt der Straße. Später, als die Zeit nach fünf Jahren für kurze drei Sekunden weiterläuft, trifft Adrian die anderen Chronifizierten wieder, um herauszufinden, ob das am CERN zurückgebliebene Forscherteam es tatsächlich geschafft hat, eine Lösung für das Problem zu finden. Doch auf dem Rückweg begegnet er witzigen und auch bizarren Menschenskulpturen aus den Körpern der erstarrten, die einige der Chronifizierten in den Jahren der Unzeit geschaffen haben, er stößt auf Mord und Missgunst unter den Überlebenden.
In Douglas Adams’ Per Anhalter durch die Galaxis ist die Zahl 42 die Antwort auf »die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest«; und auch, wenn Lehr, wie der Titel wohl so manchem Anhalter-Enthusiasten zunächst suggeriert, sich nicht direkt darauf bezieht, ist die 42 auch hier eine überraschende wie schreckliche Antwort. Die meisten Leser wird das Buch wohl fasziniert wie ratlos zurücklassen, weil zum Ende mehr und mehr physikalische Theoreme in die teilweise expressionistisch anmutende Beschreibung einfließen. Vielleicht also ist ein entsprechend geschulter Physiker der einzig wahre Leser von 42.
Viel wichtiger erscheint aber die verzweifelte Reise Haffners, der voller Sehnsucht durch die erstarrte, zugleich voll von Menschen und doch gottverlassene Welt zieht; Sehnsucht nach seiner Frau, Sehnsucht nach Anna, einer chronifizierten Kollegin, die mit Boris zusammen ist und sich doch zu Haffner hingezogen fühlt, Sehnsucht nach der Rückkehr einer bewegten Welt. Die Sprache, in der all das stattfindet, spiegelt die Schwere, Gewundenheit und tiefe Melancholie Haffners wider; und obgleich sie das komplizierte physikalische Geschehen teilweise unverständlich erscheinen lässt, ist auf der künstlerischen Seite umso meisterhafter, was Lehr aus deren Konsequenzen macht: In einer vierseitigen Sequenz beschreibt er, wie der während des dreisekündigen »Rucks« auf der Straße zerschellte Nebenbuhler in Folge einer Zeitumkehr unter umgekehrten Vorzeichen vom Tod zurück ins Leben und von der Straße zurück in das Fenster seines Hotelzimmers fliegt.
Für den Leser sind das Buch und seine hochkomplexe und kunstvoll gedrechselte Sprache manchmal ebenso schwer zu durchdringen wie für seinen Helden Haffner die eingeschlafene Welt, die sich nicht mehr dreht und in deren Logik sich beide Ebenen, Leser wie Figur, gleichermaßen verstricken – und gerade, weil die Sprache so perfekt die verzweifelte Situation des »Chronifizierten« wiedergibt, bedeutet 42 für den Leser nicht dasselbe, wie für die Romanfiguren: den Tod.
Thomas Lehr: 42. Roman. Hanser, 2013, 21,90 €. E-Buch 16,99 €.
Hate Radio
Veröffentlicht am 6. Februar 2015
Die Rolle eines Mediums als Täterplattform und Anheizer des Völkermordes in Ruanda
von Christian Wobig
»Die authentischen Künstler der Gegenwart sind die, in deren Werken das äußerste Grauen nachzittert«, schrieb Adorno einst – eine Position, die Viele 70 Jahre nach dem Holocaust für historisch halten mögen; doch sie ist eine der zentralen philosophischen Aussagen des »Jahrhunderts der Genozide«, in dem jenes Grauen der politisch organisierten Vernichtung menschlichen Lebens nach 1945 nicht beendet, sondern regelmäßig aktualisiert worden ist.
Kann aber ein Radiomoderator den Tod von Menschen verschulden, eine kleine, private Radiostation in einem kleinen Land irgendwo in Ostafrika eine zentrale Rolle bei der Ermordung von fast einer Million Menschen spielen? Seit 1994 wissen wir, dass es geht; der Ort: Ruanda. Der Tatort: Eine kleine, junge Radiostation im Herzen Kigalis, Radio-Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), seit 1993 auf Sendung. In dem kleinen, ostafrikanischen Land, dessen Bevölkerung zu großen Teilen aus Analphabeten bestand und in dem sich kaum jemand Fernseher leisten konnte, kam dem Radio die Rolle des Leitmediums zu. RTLM traf mit seiner unkonventionellen Art den Nerv der Zeit. Dabei waren ein gemischt westliches wie afrikanisches Musikprogramm und eine landesuntypisch sehr lockere Sprache von Sendestart an mit politischer Hass-Propaganda gegen die Tutsi-Minderheit kombiniert worden – eine Vorgehensweise, die aus der Rückschau wie eine Werbekampagne zur Vorbereitung des Völkermords anmutet. In den Monaten vor dem Beginn des hunderttägigen Mordens am 6. April bereits eng mit der »Hutu-Power«-Bewegung und den extremistischen Kräften innerhalb der Hutu-Regierung verstrickt, sendete RTLM den landesweiten Startschuss für das Morden (»fällt die hohen Bäume«), schürte den Hass, las Todeslisten vor, auf denen nicht nur Tutsi, sondern auch gemäßigte Hutu standen, stachelte die Mörder an und wies ihnen den Weg zu weiteren Opfern.
Bis heute gilt der Genozid in Ruanda als herausragendes Beispiel dafür, welche wichtige Rolle moderne Medien bei der Entfesselung und Kontrolle kollektiver Gewalt spielen; in seinem gleichnamigen Theaterstück zeigt der Schweizer Theaterregisseur Milo Rau, eingerahmt von Zeugenaussagen, eine typische Sendestunde, wie sie das »Hate Radio« RTLM während des Mordens ausgestrahlt haben könnte. Zum 2011 uraufgeführten Stück ist – pünktlich zum 20-jährigen Gedenktag des Genozids – Anfang 2014 im Verbrecher-Verlag ein Begleitband mit Interviews, Dokumenten und Begleitinformationen erschienen, der Einblicke in den Hintergrund des Theaterstücks liefert. Neben Auszügen aus den Interviews, die Rau im Laufe seiner Recherchearbeit mit Zeitzeugen und Tätern wie der RTLM-Moderatorin Valérie Bemeriki führte, und aus Vernehmungsprotokollen der Gerichtsverfahren gegen die Hassmedien Ruandas, lassen sich auch Untersuchungen über die Sprache des Genozides in Ruanda finden, in der das Morden als »Arbeit«, die Mordinstrumente als »Werkzeug« und die Opfer als »Inyenzi«, »Kakerlaken« bezeichnet wurden. In einem Aufsatz verdeutlicht der renommierte Genozidforscher Frank Chalk die Rolle der Medien, die sich aus den Erfahrungen mit RTLM und anderen Hassmedien Ruandas ergibt. Moderne Medien, so Chalk, spielten eine zentrale Rolle für die Verbreitung von Hassideologien und würden durch die Täter genutzt, um die Angst der eigenen Zielgruppe vor einer Bedrohung durch die zukünftigen Opfer zu schüren. Gleichzeitig böten sie aber auch die Chance, Informationen zu verbreiten, die einen Ausbruch von Gewalt verhinderten. Die Erfahrung aus Ruanda müsse, so Chalk, eine konsequente Ausschaltung von »Hate-Media«, eine Gegenkampagne mit objektiven Informationen und eine entschiedene Strafverfolgung von Tätern nach sich ziehen.
Der gleichnamige Band zu Milo Raus Theaterstück Hate-Radio, der auch ein deutsches Transkript des Stückes enthält, ist eine sinnvolle Ergänzung, da er vertieft, was bereits auf der Bühne erreicht wird: Die Bedeutung von Hasspropaganda und die gesellschaftliche Dimension der Entfesselung von kollektiver Gewalt zu veranschaulichen, die nicht allein ein Phänomen moderner Ideologien ist, sondern ein mit der Moderne an sich einhergehendes, das sich aus vielen, teilweise widersprüchlichen gesellschaftlichen Entwicklungen speist. Dies ist eine wichtige Erkenntnis, sie macht deutlich, dass jeder Völkermord, ob an Juden, Armeniern, Tutsi oder den vielen anderen Opfern, zwar an sich einzigartig ist, keiner von ihnen jedoch einen Bruch mit der Entwicklung der modernen »Zivilisation« bedeutet, sondern mit ihr einhergeht: »Ich glaube nicht an das Ende der Genozide. Ich glaube nicht, dass wir zum letzten Mal diese schlimmste aller Grausamkeiten erlebt haben. Wenn es einen Genozid gegeben hat, dann wird es noch viele geben.«
Milo Rau: Hate Radio. Verbrecher Verlag, 2014, 18,00 €.
Heimat im Ruhrgebiet Poetry Slammer berichten über den Ort, für den ihr Herz schlägt
Veröffentlicht am 6. Februar 2015
von Anika Lehnert
»Wat is dat denn?«, fragt man sich, wenn man dieses kleine Bändchen namens Pottpoesie, herausgegeben von Dea Sinik, in den Händen hält. Es ist der beste Beweis dafür, dass die Ruhrgebietskultur viel mehr ausmacht als nur Bergbaumentalität mit Vorliebe für »’ne ordentliche Mantaplatte« zwischendurch. Das Ruhrgebiet mit seinen fünf Millionen Einwohnern ist Heimat unterschiedlichster Kulturen auf relativ kleiner Fläche. Hinter jedem Menschen verbirgt sich eine individuelle Lebensgeschichte, die nicht selten mit der Flüchtlingsthematik verknüpft ist. So stellt sich bei vielen die Frage: Wo ist meine Heimat und was macht sie aus?
Eine Antwort auf diese Frage verspricht die Pottpoesie zu geben. In dem knapp 100 Seiten umfassenden Sammelband trägt Herausgeberin Dea Sinik eine Vielzahl an Texten zusammen, die einerseits im Rahmen der Poetry Slams in Gelsenkirchen-Buer, andererseits in Schreibwerkstätten entstanden, die in den letzten Jahren unter der Regie der Germanistik-Studentin organisiert wurden. Auch von Sinik selbst sind zwei Texte in dem Band enthalten, in denen sich wunderbare Zeilen lesen lassen, wie die folgenden: »Am liebsten würde ich das Leben in Konserven verpacken, mir jedes Fitzel von Freude jetzt schnappen, um meinen Körper von der Trauer zu entschlacken« oder »Wenn manchmal schon viel gesagt wurde, bleiben einem keine Worte mehr übrig für das letzte Mal. […] Das Universum hatte einen Cocktail serviert, den ich nicht zu trinken bereit war.«
Gibt es Antworten auf die Frage, was Heimat im Ruhrgebiet bedeutet? Ja, es gibt sie. Sie werden beispielsweise von Tobias Heimann geliefert, der sagt: »Ich fühle mich wohl hier, wo die Leute manchmal schon etwas zu ehrlich sind und man baufällige Ruinen Industriekultur nennt. Hier habe ich all diese Erinnerung[en], all diese Menschen, all diese Plätze. All das ist Heimat. All das ist in mir.«
Aber das heimische Gefühl muss nicht zwangläufig an die Spezifika einer Region, wie die Zechen des Ruhrgebiets, gebunden sein: »Heimat ist ein Wohlfühlmoment. Du nennst es albern? Ich nenn es Heimat. […] Heimat ist kein Ort, Heimat ist so viel mehr«, umschreibt es Tobias Reinartz in seinem Slam Wohlfühlmoment. In Titeln wie Ketten der Heimat von Nina Anin oder Der nicht-integrierbare Teil von Ilja Budinzkij lässt sich erahnen, dass die Suche nach einem Heimatbegriff oftmals damit einhergeht, sein altes Leben hinter sich zu lassen um irgendwo anders neu anzufangen – unter welchen Umständen auch immer. In diesen Texten blitzt hinter der witzigen Fassade eines Poetry Slams Nachdenklichkeit hervor. Dahingegen liefert der Sammelband die amüsantesten Momente in den skurillen Anekdoten Auf dem Land von Tobias Reinartz und Wie Frühjahrsputz aus mir einen Abenteurer und Eremiten machte von Felix Bartsch. Während die eine Geschichte uns im Trend von Serien wie The Walking Dead erklärt, dass Landwirte zum Schutze der Menschheit gar nicht Heu, sondern Zombies gabeln, entdeckt der Protagonist der anderen Erzählung einen Untermieter in seinem Schrank. Obschon diese beiden Geschichten nicht viel mit dem engeren Heimatbegriff verbindet, tragen sie doch enorm zum Unterhaltungswert des Sammelbandes bei.
Die schönste Erzählung des Bandes ist jedoch die Geschichte namens Sommertraum von Andre Kalwitzki, der uns in seine alte Heimat an die Nordsee mitnimmt. Atmosphärisch beschreibt er das Wiedersehen mit einem geliebten Menschen nach langer Zeit. »Vielleicht war ich nicht mehr der Mensch, der ich einmal zu sein pflegte. Vielleicht habe ich einen Teil von mir damals hier allein sterben lassen, als ich in die Großstadt zog, um Karriere zu machen. Vielleicht lebte dieser Teil auch hier weiter und ließ mich in der Großstadt sterben. […] Ja, an einem Tag im August erkennt man erst, wie schön schöne Zeiten wirklich gewesen waren und was man seither wirklich vermisst.«
Dea Siniks Sammelband Pottpoesie liefert uns Antwortmöglichkeiten darauf, was Heimat für einige Menschen im Ruhrgebiet bedeutet und es lässt uns nach der letzten Seite mit der Frage zurück: Was bedeutet Heimat eigentlich für mich?
Dea Sinik (Hrsg.): Pottpoesie. Heimat. Westflügel Verlag, 2013, 9,99 €.
Über das Ruhrgebietsdeutsch
Veröffentlicht am 6. Februar 2015
Willkommen in den sprachlichen Tiefen vonnen Ruhrgebietsdialekt
von Kim Uridat
Mein lieber Kokoschinski! Mein lieber WAS? – wir beginnen mit einem Ausdruck, der bei Nichtkennern des Ruhrgebiets oder jenen, die sich zu seinen Sympathisanten zählen dürfen, zunächst für Verwunderung sorgen dürfte. Kokoschinski, wer soll das denn sein? Was will der Sprecher damit sagen? Noch nie gehört? Dann kann dieses unterhaltsame Buch über den Ruhrdialekt einige hilfreiche Ansätze bieten.
Heinz H. Menge, der als Professor an der Ruhr-Universität Bochum gelehrt hat, stellt in seinem Band Mein lieber Kokoschinski! Der Ruhrdialekt einen Dialekt vor, der laut Titel aus der »farbigsten Sprachlandschaft Deutschlands« stammt. Und das ist nicht zuviel versprochen, gibt es doch sehr viele Ausdrücke, die zum Beispiel aus dem Jiddischen stammen, wie »Stickum«. Oder auch aus dem Plattdeutschen, denn Heinz H. Menge hält fest, dass die Bochumer »Klockerigge« mit ihrer Endung auf plattdeutsche Wurzeln hinweist. Typische Dortmunder Ausdrücke wie »tofte oder Maloche«, Worte, die viele Menschen in und auch außerhalb des Ruhrpotts kennen, werden ebenso erklärt und erfahren hier eine sprachliche Einordnung. Und heraus stellt sich auch, dass Maloche durch seinen jiddischen Hintergrund auf dem O betont werden muss und warum das O in »Bochum« lang ausgesprochen wird, wenn es zum Beispiel in den Fangesängen im Bochumer Fußballstadion erklingt. Warum gibt es Wittkowskis und Witkowskis, warum fällt ein t weg und woher kommt eigentlich das Wort »Mattka« und was bedeutet es? Fragen, die dieses Buch umfassend und intelligent beantwortet. Anschaulich erklärt Menge außerdem, warum in der Geschichte des Ruhrgebiets mancher Nachname abgeändert wurde, welche neuen Namensformen sich dabei ergaben und auch, warum es in der sich wandelnden Industrieregion des alten Kohlenpotts viele Familien mit polnischen oder masurischen Wurzeln gibt.
Des Weiteren geht der Band nicht nur der Frage nach, was das Ruhrgebiet eigentlich ist, sondern auch, welche Bevölkerungsgruppen Einfluss auf den Sprachgebrauch und somit auch auf den Ruhrdialekt haben. Eine gute Nachricht für Sprecher des Ruhrdialekts wird mit der Kapitelüberschrift »Das beste Deutsch: Etwa im Ruhrgebiet? – Ja, echt!« eröffnet, denn Hannover trage den inoffiziellen Titel der Sprachpfleger nur aus einer Behauptung heraus. Menge relativiert dann aber doch augenzwinkernd: »Man hört es nicht unbedingt auf der Straße«. Immerhin, der Ruhri hat gute Anlagen, irgendwann das beste Deutsch zu sprechen und wenn nicht, bleibt in jedem Fall der Ruhrdialekt mit allen seinen Finessen und Besonderheiten erhalten.
Heinz H. Menge analysiert mit Mein lieber Kokoschinski, den Ruhrdialekt wissenschaftlich und dennoch anschaulich, beleuchtet die Hintergründe dieser regionalen Formen und zeigt ihre Auffälligkeiten. Gleichzeitig spiegelt er damit auch wider, was die gern als etwas schnodderig gescholtenen Ruhrdialektsprecher sprachlich auszeichnet und was die Region vor allem aus sprachlicher Sicht zu einer besonderen macht. Es ist ein Buch über den Ruhrdialekt, in dem man sich als Sprecher wiederfinden und als Neuankömmling Erstaunliches und Unbekanntes entdecken kann.
Heinz H. Menge: Mein lieber Kokoschinski. Der Ruhrdialekt. Aus der farbigsten Sprachlandschaft Deutschlands. Henselowsky und Boschmann, 2013, 9,90 €.
Die Banalität der Böswilligkeit – Louis-Ferdinand Célines Reise ans Ende der Nacht ist kein klassischer Weltkriegsroman
Veröffentlicht am 6. Februar 2015
von Christian Wobig
»Ich bin kein Misanthrop, ich hasse einfach nur Menschen« – diese Worte des Bochumer Kabarettisten Jochen Malmsheimer könnte man auch die literarische Reizfigur Louis Ferdinand Céline angesichts des vorliegenden Werkes von 1932 in den Mund legen – und für diesen Hass, diese Abneigung, das wird schnell klar, hat er auch allerlei Gründe. Der Erste Weltkrieg, an dem er beinahe aus Versehen teilnimmt, ist zwar das Extrem der gesellschaftlichen Spaltung und Ausnutzung, doch ist er nach Célines Meinung eben nur die ›Fortsetzung der friedenszeitlichen Unterdrückung mit anderen Mitteln‹.
Hauptfigur in Célines Roman ist Ferdinand Bardamu, dessen Geschichte mit einem ganz persönlichen »August-Erlebnis« beginnt. Als junger Pariser Medizinstudent und schließlich Soldat im Ersten Weltkrieg, Kriegsneurotiker, Kolonialverwalter in Afrika, illegaler Einwanderer und später auch als Angestellter im US-Gesundheitssystem vagabundiert er durch die Welt. Zuletzt beendet er in Frankreich sein Medizinstudium und arbeitet zunächst als Armen-, dann als »Irrenarzt« und schließlich als Klinikchef in einem Pariser Vorort.
Bardamu verfügt von Anfang an über jenen misanthropischen Blick auf die Menschen, der ihm jedes noch so kleine Glück aufs Schnellste verleidet, weil er als fad und unecht durchschaut. Den Krieg durchleidet Célines Bardamu in ständiger Todesangst, getrieben zwischen dem »bisschen Sterben gehen« am Tag und der Schufterei im nächtlichen Feldlager, immer auf der Suche nach dem sich nie bietenden Ausweg. Als er sich schließlich gefangen nehmen lassen will, trifft er auf Robinson, der das gleiche Ansinnen hat und dem er in den folgenden Jahren immer wieder begegnen wird.
Nach dem Krieg bleibt Bardamu noch eine Zeitlang in Paris, flüchtet jedoch vor der Armut auf ein Schiff nach Afrika, um in den französischen Kolonien als Verwaltungsbeamter zu arbeiten. Doch in der Hitze des schwarzen Kontinents, stellt Bardamu fest, »zeigten die Weißen ihren wahren Charakter; er wurde dem entsetzten Beobachter völlig hüllen- und hemmungslos zur Schau gestellt. Man lernte die wirkliche Natur des Menschen kennen, so wie seinerzeit im Krieg.« In den Tropen offenbart sich der ganze Wahnsinn des kolonialen Unternehmens, schmelzen die versprengten Kolonialbeamten in der Hölle des Dschungels förmlich dahin; Bardamu flieht nach Amerika, gerät als Flohstatistiker in das Gesundheits- und Einwanderungssystem der Vereinigten Staaten und arbeitet für einen Hygienebeamten, der Mischief (zu Deutsch: Unsinn) heißt. Zurück in Frankreich beendet er sein Medizinstudium und praktiziert als von seinen Patienten geprellter und verachteter Armenarzt in Paris, bis er später in den Dienst einer »Irrenanstalt« eintritt.
Unter der Oberfläche der Zivilisation, so zeigt es Célines Roman, herrscht auch im Frieden noch Krieg und grausames Gemetzel, in dem Menschen erbarmungslos gegeneinander zu Felde ziehen. Für das Individuum bleibt als einzige Lösung, sich auf die richtige Seite der beiden Fronten zu bringen. Während Bardamu die Natur hasst, scheint er die Zivilisation noch weniger leiden zu können, denn den Eingeborenen ist z. B. »nur mit der Peitsche beizukommen«. Sie, so Célines Menschenverächter, hätten noch Stolz, während die Weißen durch Bildung bereits zum Gehorsam erzogen seien – eine Ausdeutung, die den europäischen Kolonialgedanken, der sich in der Pflicht zur ›Zivilisierung der Wilden‹ sieht, aufs Pessimistischste und Konsequenteste zu Ende denkt.
Céline, bürgerlich eigentlich Louis-Ferdinand Destouches, hatte bereits als Seuchenmediziner Karriere gemacht, als er mit »Reise ans Ende der Nacht« 1932 schlagartig berühmt wurde. Besonders in der Linken fand Célines Roman großen Zuspruch; in dem er größtenteils eine einfache, nämlich die Pariser Gossensprache nutzte, gab er dem Empfinden des (auch im Roman im Mittelpunkt stehenden) »Kleinen Mannes« der Unterschicht eine Stimme. Während die Reise noch als schonungslose und entlarvende Sozialkritik gelesen werden konnte, waren das 1936 erschienene Nachfolgewerk Tod auf Kredit und der im Folgejahr erscheinende Text Bagatelles pour une massacre (in Deutschland erschienen als Die Judenverschwörung in Frankreich) in wahllose Misanthropie und offenen Antisemitismus umgeschlagen. Auch politisch sympathisierte Céline offen mit dem Faschismus und war in das Vichy-Regime des Marschalls Petain verstrickt, weswegen er nach dem Krieg weitgehend aus dem intellektuellen Leben Frankreichs ausgeschlossen war. Er lebte bis zu seinem Tod 1961 in einem kleinen Ort in der Nähe von Paris und arbeitete als praktischer Arzt, vielleicht auch, weil er sich zeitlebens nie von seinen menschenverachtenden Ausfällen der Zwischen- und Vorkriegszeit distanzierte, sondern sich eher noch als seniler Verrückter gerierte. Wie weit der Hass bei Céline wirklich ging, wurde erst nach kurz nach seinem Tod durch die Veröffentlichung seiner Tagebuchaufzeichnungen klar.
Bei aller Verstrickung seines Autors in die Untiefen des Faschismus, dessen menschenverachtende Rhetorik und Denkweise großes Leid ausgelöst hat, bleibt Reise ans Ende der Nacht ein herausragender Roman. Die Reise ist kein klassischer Weltkriegsroman, die Beschreibung des Krieges und seiner unmittelbaren Folgen nimmt nicht einmal ein Viertel des Buches ein. Zugleich aber ist er doch der entscheidende Fluchtpunkt, dessen Perspektivlinien Bardamu auf seiner Flucht vor dem Leiden und der Angst in der Gesellschaft entdeckt, selbst fern jeder Zivilisation. Es gibt kein Entrinnen, »so wie im Krieg. Nichts geschieht. Niemand kommt und hilft.«
Offen aber bleibt die Frage: Ist die Menschheit so verroht, so eigennützig, so bestialisch, die Zivilisation kein Ausweg aus dieser Verrohung, sondern lediglich ihre Instrumentalisierung? Das ist sicher nicht ausgemacht; Zweifellos aber war Célines Roman ein Skandal, weil er die Grundgewissheiten der demokratischen Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts radikal in Frage stellte und sowohl den Kapitalismus als auch das Kolonialsystem und den Krieg in all seinen zweifelhaften Abgründen anprangerte. Céline entlarvt in diesem Roman alle humanen Bemühungen um Ordnung und Gerechtigkeit als »Mischief«, also als Unsinn, dem niemand wirklich entkommen kann – es bleibt nur diese eine grausame und zutiefst ungerechte Welt, in der man sich einrichten muss. Die Fragen, die der Roman damit aufwirft, haben auch heute nicht an Aktualität verloren. Sie sind eine Quelle der tiefen Melancholie geblieben, die Bardamu einmal so zynisch zusammenfasst:
»Ich war ja übrigens selber boshaft, alle Menschen sind es… Alles Übrige habe ich auf dem Wege eingebüßt, ja die Miene selbst, die man für Sterbende aufsetzt, auch die hatte ich verloren. Mein Gefühl ist einem Haus vergleichbar, in das man nur in den Ferien eintritt. Es ist kaum bewohnbar.«
90.0 MHz – Das hörst du! Das Bochumer Campusradio CT das radio und die fusznote kooperieren seit dem Sommersemester 2014
Veröffentlicht am 6. Februar 2015
von Anika Lehnert
Sie sitzen in den Untiefen der Ruhr-Universität Bochum. In einem Abschnitt, den kaum ein Germanistik-Studierender je zu Gesicht bekommen hat, oder von dem er auch nur weiß, dass jenseits der Mittelachse, in der die UB beheimatet ist, noch Leben existiert. Im Gebäude ICN liegen die Räume von CT das radio, dem studentisch geführten Radiosender für die Ruhr-Universität und die Hochschule Bochum, die Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe sowie die Technische Fachhochschule Georg Agricola. 24 Stunden non-stop sendet das älteste Campusradio in NRW für die Bochumer Studierenden und versorgt die Hörer nicht nur mit Musik, sondern auch mit allem Wissenswerten aus der Welt, der Umgebung und nicht zuletzt mit Neuigkeiten vom Campus. Wer täglich auf der Frequenz 90.0 MHz oder schlicht per Live-Stream im Internet zuschaltet, der ist mit der Sparte Fresschen sogar darüber informiert, was in der Mensa auf den Tisch kommt. In mehreren technisch ausgerüsteten Räumen sitzen jeden Tag die »Gesichter des Radios« aus allen Disziplinen der Universität beisammen und erarbeiten das Programm für den jeweiligen Tag. »Wichtig ist uns der studentische Bezug in den Beiträgen«, sagt Philipp Kressmann, Musikchef und Nachrichtenredakteur bei CT, »Natürlich berichten wir auch über wichtige Geschehnisse in der Welt, aber Neuigkeiten auf dem Campus sind für uns genauso wichtig – dafür sind wir ein Campusradio.«
Dass es gar nicht so einfach ist, einen Beitrag für das Radio aufzubereiten, hat die Redaktion der fusznote in mehreren kleinen Workshops persönlich erfahren. Unter der Anleitung von Philipp Kressmann und Ann-Kristin Pott, Programmchefin und Moderatorin, lernen wir unser germanistisches Wissen um den Aufbau eines »runden Textes« über den Haufen zu werfen und wieder bei Null anzufangen. Vergessen sollte man kunstvoll kreierte Haupt- und Nebensatz-Konstruktionen und den exzessiven Einsatz komplizierter Fachbegriffe. Reduktion ist das Stichwort! Denn das Ohr kann bei Weitem nicht so schnell Informationen erfassen wie das Auge beim Lesen eines Textes. »Bei einem Radio-Beitrag ist darauf zu achten«, so Ann-Kristin, »den Hörer direkt abzuholen.« Das heißt so viel wie: Der Hörer hört den Beitrag nur einmal und muss Schritt für Schritt an das Thema herangeführt werden, sonst schaltet er ab. »Besonders gut eignen sich auch bildhafte Formulierungen«, ergänzt Philipp noch, »denn so wird das Gehörte gleich viel lebendiger und leichter vorstellbar.«
CT das radio, dessen Name, so eine der Gründungslegenden, abgeleitet ist vom lateinischen »cum tempore«, das den Studierenden besser bekannt ist als das »akademische Viertel«, sendet seit 1997 aus Bochum und versteht sich selbst als Ausbildungs-Radio. Alle Studierenden sämtlicher Sparten haben die Möglichkeit sich dort zu engagieren. Der Einstieg erfolgt über ein halbjähriges Praktikum, das auch für den Optionalbereich angerechnet werden kann. Ebenso betreuen die Redakteure in dem großen Redaktionsraum mit unzähligen Rechnern Schüler, die im Rahmen des Praktikums Radioluft schnuppern wollen.
CT hat eine technische Reichweite von knapp 500 000 Menschen und bietet mit seinem größtenteils indielastigen Musikprogramm eine angenehme Alternative zu den großen Sendern. Doch kann das Radio in Hinblick auf das richtige Gespür für neue Trends den bekannteren Funkern durchaus das Wasser reichen. »Lange bevor aktuelle Interpreten wie Lykke Li mit ihrem Erfolgshit I follow Rivers oder Milky Chance mit Stolen Dance Standard wurden, hatte CT sie schon einige Monate im Programm«, erzählt Philipp, der verantwortlich für die Musikauswahl ist. Um zu vermeiden, dass Bands oder Interpreten schnell »totgespielt« werden, gibt es bei CT die Regel, dass ein Titel nicht zu oft am Tag gespielt werden darf. Mit den Sparten »Hörtest der Woche« und »Silberling der Woche«, die in Kooperation mit eldoradio* zustande kommen, wird darüber hinaus wöchentlich eine Neuerscheinung im Studio besprochen, die auf der Homepage auch in Rezensionsform nachzulesen ist. Doch nicht nur mit seinen vielseitigen Musiksendungen, die von den Campus-Charts über House und Reggae bis Metal reichen und zwischen 20 und 22 Uhr täglich variieren, bietet CT den Hörern ein abwechslungsreiches Repertoire. Auch kulturelle Tipps und Kritiken von Theateraufführungen oder Konzerten kommen im Programm nicht zu kurz. Insbesondere der Mittwochabend von 21 bis 22 Uhr bietet hierbei mit der Sendung »Kultimativ« allen Kulturfreunden Inspiration für die nächsten Abende.
Seit dem Sommersemester 2014 verbindet fusznote und CT das radio eine Kooperation. In regelmäßigen Abständen präsentieren die Redaktionsmitglieder der fusznote Neuerscheinungen aus dem Buchmarkt und liefern Anregungen für die nächste, nicht nur studentische Lektüre. Auch anstehende Lesungen oder Literaturfestivals werden vorgestellt, sodass Leseratten und vielleicht auch mancher vermeintliche Kulturmuffel etwas für seinen Geschmack findet.
Letzte Artikel
- Teil der Lösung – Plädoyer für ein bedingungsloses Grundeinkommen
- Stillstand ist der Tod: In Thomas Lehrs Roman "42" steht die Zeit still – und quält den Protagonisten
- Hate Radio
- Heimat im Ruhrgebiet Poetry Slammer berichten über den Ort, für den ihr Herz schlägt
- Über das Ruhrgebietsdeutsch
Archive
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Mai 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013