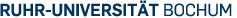Aktuelle Mitteilungen
Teil der Lösung – Plädoyer für ein bedingungsloses Grundeinkommen
Veröffentlicht am 17. Februar 2015
von Kim Uridat
Die Debatte um das Grundeinkommen ist eine polarisierende und eine teilweise hitzig geführte, die sich häufig in die Pro- und Contra-Position teilt und manchmal auch darin verliert. Der Frage, wie ein Grundeinkommen aussehen könnte und welche Vorteile dies haben kann, gehen die Herausgeber Ronald Blaschke und Werner Ratz nach und untersuchen in ihrem Buch die »Sicherheit des Einkommens« und wie entscheidend wirtschaftliche Zusammenhänge gerade in Krisenzeiten sind. Das Grundeinkommen, so stellen es die Autoren vor, muss bestimmte Bedingungen erfüllen, sie vermeiden dabei trotz ihres Standpunktes plakative Polarisierungen, auch wenn sie sich von Arbeiten wie Irrweg Grundeinkommen von Heiner Flassbeck, Friederike Spiecker, Volker Meinhardt und Dieter Vesper abgrenzen wollen. Das Plädoyer für ein Grundeinkommen besteht aus 12 Essays, die unterschiedliche Aspekte des Themas beleuchten. Darunter fällt die Forderung, das Grundeinkommen durch eine Volksabstimmung einzuführen, und natürlich die entscheidende Frage nach der Finanzierung. Blaschke stellt in seinem Essay »Irrweg Marktmensch« vor, welches Gesellschaftsbild unsere heutige Welt prägt, die von einer starken und »dominante[n] marktradikale[n]« Ausrichtung geprägt ist, die das Wirtschafts-, Arbeits- und gesellschaftliche Leben in starker Weise beeinflusst. Bei der Vorstellung, die in Blaschkes Text thematisiert wird, handelt es sich um ein Modell, das nicht von Leistung abhängt, wie es sonst im Wirtschaftsleben zum Großteil der Fall ist. Antje Schrupp greift in ihrem Essay »Erkennen was notwendig ist« die Tatsache auf, dass eine häufige kritische Haltung gegenüber dem Grundeinkommen genau aus der Negierung oder Abkopplung des Leistungsaspektes resultiert und sie sich durchaus darüber bewusst sei, dass darin auch ein Knackpunkt liegen kann. Leistung ist ein omnipräsenter Begriff in allen Lebenslagen, also auch bei der Frage des Grundeinkommens. Die einzelnen Essays sind vielschichtig, detailliert und stellen Fragen zum Kapitalismus, zur Arbeit und Arbeitsleistung und zur Gesellschaft. Die Frage nach Bürgergeld oder Grundeinkommen bleibt ein strittiges Thema, aber unabhängig davon, ob man sich für oder gegen ein solches Modell entscheidet, sollte man die Papptafeln mit »Ich bin dafür« oder »Ich bin dagegen« erst einmal entsorgen, denn das Plädoyer von Blaschke und Ratz liefert Argumente für ein Grundeinkommen, bringt den Leser allerdings ebenso dazu, sich selbst kritische Fragen zu stellen und eine eigene Meinung zur der Frage des Grundeinkommens zu bilden. Auch wenn das Thema in diesem Buch sehr komplex dargestellt wird, arbeiten auch die einzelnen Autoren kritische Punkte heraus, sodass sich das Buch in keiner Weise damit zufrieden gibt, eine simple Streitschrift zu sein. Es liefert keinesfalls einfache Antworten auf eine Frage, die nicht nur politisch, sondern vor allem gesellschaftlich relevant ist, und es gibt wertvolle Denkanstöße zum Weiterlesen.
Ronald Blaschke, Werner Rätz (Hrsg.): Teil der Lösung. Plädoyer für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Rotpunkt, 2013, 17,90 €.
Heimat im Ruhrgebiet Poetry Slammer berichten über den Ort, für den ihr Herz schlägt
Veröffentlicht am 6. Februar 2015
von Anika Lehnert
»Wat is dat denn?«, fragt man sich, wenn man dieses kleine Bändchen namens Pottpoesie, herausgegeben von Dea Sinik, in den Händen hält. Es ist der beste Beweis dafür, dass die Ruhrgebietskultur viel mehr ausmacht als nur Bergbaumentalität mit Vorliebe für »’ne ordentliche Mantaplatte« zwischendurch. Das Ruhrgebiet mit seinen fünf Millionen Einwohnern ist Heimat unterschiedlichster Kulturen auf relativ kleiner Fläche. Hinter jedem Menschen verbirgt sich eine individuelle Lebensgeschichte, die nicht selten mit der Flüchtlingsthematik verknüpft ist. So stellt sich bei vielen die Frage: Wo ist meine Heimat und was macht sie aus?
Eine Antwort auf diese Frage verspricht die Pottpoesie zu geben. In dem knapp 100 Seiten umfassenden Sammelband trägt Herausgeberin Dea Sinik eine Vielzahl an Texten zusammen, die einerseits im Rahmen der Poetry Slams in Gelsenkirchen-Buer, andererseits in Schreibwerkstätten entstanden, die in den letzten Jahren unter der Regie der Germanistik-Studentin organisiert wurden. Auch von Sinik selbst sind zwei Texte in dem Band enthalten, in denen sich wunderbare Zeilen lesen lassen, wie die folgenden: »Am liebsten würde ich das Leben in Konserven verpacken, mir jedes Fitzel von Freude jetzt schnappen, um meinen Körper von der Trauer zu entschlacken« oder »Wenn manchmal schon viel gesagt wurde, bleiben einem keine Worte mehr übrig für das letzte Mal. […] Das Universum hatte einen Cocktail serviert, den ich nicht zu trinken bereit war.«
Gibt es Antworten auf die Frage, was Heimat im Ruhrgebiet bedeutet? Ja, es gibt sie. Sie werden beispielsweise von Tobias Heimann geliefert, der sagt: »Ich fühle mich wohl hier, wo die Leute manchmal schon etwas zu ehrlich sind und man baufällige Ruinen Industriekultur nennt. Hier habe ich all diese Erinnerung[en], all diese Menschen, all diese Plätze. All das ist Heimat. All das ist in mir.«
Aber das heimische Gefühl muss nicht zwangläufig an die Spezifika einer Region, wie die Zechen des Ruhrgebiets, gebunden sein: »Heimat ist ein Wohlfühlmoment. Du nennst es albern? Ich nenn es Heimat. […] Heimat ist kein Ort, Heimat ist so viel mehr«, umschreibt es Tobias Reinartz in seinem Slam Wohlfühlmoment. In Titeln wie Ketten der Heimat von Nina Anin oder Der nicht-integrierbare Teil von Ilja Budinzkij lässt sich erahnen, dass die Suche nach einem Heimatbegriff oftmals damit einhergeht, sein altes Leben hinter sich zu lassen um irgendwo anders neu anzufangen – unter welchen Umständen auch immer. In diesen Texten blitzt hinter der witzigen Fassade eines Poetry Slams Nachdenklichkeit hervor. Dahingegen liefert der Sammelband die amüsantesten Momente in den skurillen Anekdoten Auf dem Land von Tobias Reinartz und Wie Frühjahrsputz aus mir einen Abenteurer und Eremiten machte von Felix Bartsch. Während die eine Geschichte uns im Trend von Serien wie The Walking Dead erklärt, dass Landwirte zum Schutze der Menschheit gar nicht Heu, sondern Zombies gabeln, entdeckt der Protagonist der anderen Erzählung einen Untermieter in seinem Schrank. Obschon diese beiden Geschichten nicht viel mit dem engeren Heimatbegriff verbindet, tragen sie doch enorm zum Unterhaltungswert des Sammelbandes bei.
Die schönste Erzählung des Bandes ist jedoch die Geschichte namens Sommertraum von Andre Kalwitzki, der uns in seine alte Heimat an die Nordsee mitnimmt. Atmosphärisch beschreibt er das Wiedersehen mit einem geliebten Menschen nach langer Zeit. »Vielleicht war ich nicht mehr der Mensch, der ich einmal zu sein pflegte. Vielleicht habe ich einen Teil von mir damals hier allein sterben lassen, als ich in die Großstadt zog, um Karriere zu machen. Vielleicht lebte dieser Teil auch hier weiter und ließ mich in der Großstadt sterben. […] Ja, an einem Tag im August erkennt man erst, wie schön schöne Zeiten wirklich gewesen waren und was man seither wirklich vermisst.«
Dea Siniks Sammelband Pottpoesie liefert uns Antwortmöglichkeiten darauf, was Heimat für einige Menschen im Ruhrgebiet bedeutet und es lässt uns nach der letzten Seite mit der Frage zurück: Was bedeutet Heimat eigentlich für mich?
Dea Sinik (Hrsg.): Pottpoesie. Heimat. Westflügel Verlag, 2013, 9,99 €.
Über das Ruhrgebietsdeutsch
Veröffentlicht am 6. Februar 2015
Willkommen in den sprachlichen Tiefen vonnen Ruhrgebietsdialekt
von Kim Uridat
Mein lieber Kokoschinski! Mein lieber WAS? – wir beginnen mit einem Ausdruck, der bei Nichtkennern des Ruhrgebiets oder jenen, die sich zu seinen Sympathisanten zählen dürfen, zunächst für Verwunderung sorgen dürfte. Kokoschinski, wer soll das denn sein? Was will der Sprecher damit sagen? Noch nie gehört? Dann kann dieses unterhaltsame Buch über den Ruhrdialekt einige hilfreiche Ansätze bieten.
Heinz H. Menge, der als Professor an der Ruhr-Universität Bochum gelehrt hat, stellt in seinem Band Mein lieber Kokoschinski! Der Ruhrdialekt einen Dialekt vor, der laut Titel aus der »farbigsten Sprachlandschaft Deutschlands« stammt. Und das ist nicht zuviel versprochen, gibt es doch sehr viele Ausdrücke, die zum Beispiel aus dem Jiddischen stammen, wie »Stickum«. Oder auch aus dem Plattdeutschen, denn Heinz H. Menge hält fest, dass die Bochumer »Klockerigge« mit ihrer Endung auf plattdeutsche Wurzeln hinweist. Typische Dortmunder Ausdrücke wie »tofte oder Maloche«, Worte, die viele Menschen in und auch außerhalb des Ruhrpotts kennen, werden ebenso erklärt und erfahren hier eine sprachliche Einordnung. Und heraus stellt sich auch, dass Maloche durch seinen jiddischen Hintergrund auf dem O betont werden muss und warum das O in »Bochum« lang ausgesprochen wird, wenn es zum Beispiel in den Fangesängen im Bochumer Fußballstadion erklingt. Warum gibt es Wittkowskis und Witkowskis, warum fällt ein t weg und woher kommt eigentlich das Wort »Mattka« und was bedeutet es? Fragen, die dieses Buch umfassend und intelligent beantwortet. Anschaulich erklärt Menge außerdem, warum in der Geschichte des Ruhrgebiets mancher Nachname abgeändert wurde, welche neuen Namensformen sich dabei ergaben und auch, warum es in der sich wandelnden Industrieregion des alten Kohlenpotts viele Familien mit polnischen oder masurischen Wurzeln gibt.
Des Weiteren geht der Band nicht nur der Frage nach, was das Ruhrgebiet eigentlich ist, sondern auch, welche Bevölkerungsgruppen Einfluss auf den Sprachgebrauch und somit auch auf den Ruhrdialekt haben. Eine gute Nachricht für Sprecher des Ruhrdialekts wird mit der Kapitelüberschrift »Das beste Deutsch: Etwa im Ruhrgebiet? – Ja, echt!« eröffnet, denn Hannover trage den inoffiziellen Titel der Sprachpfleger nur aus einer Behauptung heraus. Menge relativiert dann aber doch augenzwinkernd: »Man hört es nicht unbedingt auf der Straße«. Immerhin, der Ruhri hat gute Anlagen, irgendwann das beste Deutsch zu sprechen und wenn nicht, bleibt in jedem Fall der Ruhrdialekt mit allen seinen Finessen und Besonderheiten erhalten.
Heinz H. Menge analysiert mit Mein lieber Kokoschinski, den Ruhrdialekt wissenschaftlich und dennoch anschaulich, beleuchtet die Hintergründe dieser regionalen Formen und zeigt ihre Auffälligkeiten. Gleichzeitig spiegelt er damit auch wider, was die gern als etwas schnodderig gescholtenen Ruhrdialektsprecher sprachlich auszeichnet und was die Region vor allem aus sprachlicher Sicht zu einer besonderen macht. Es ist ein Buch über den Ruhrdialekt, in dem man sich als Sprecher wiederfinden und als Neuankömmling Erstaunliches und Unbekanntes entdecken kann.
Heinz H. Menge: Mein lieber Kokoschinski. Der Ruhrdialekt. Aus der farbigsten Sprachlandschaft Deutschlands. Henselowsky und Boschmann, 2013, 9,90 €.
Die Banalität der Böswilligkeit – Louis-Ferdinand Célines Reise ans Ende der Nacht ist kein klassischer Weltkriegsroman
Veröffentlicht am 6. Februar 2015
von Christian Wobig
»Ich bin kein Misanthrop, ich hasse einfach nur Menschen« – diese Worte des Bochumer Kabarettisten Jochen Malmsheimer könnte man auch die literarische Reizfigur Louis Ferdinand Céline angesichts des vorliegenden Werkes von 1932 in den Mund legen – und für diesen Hass, diese Abneigung, das wird schnell klar, hat er auch allerlei Gründe. Der Erste Weltkrieg, an dem er beinahe aus Versehen teilnimmt, ist zwar das Extrem der gesellschaftlichen Spaltung und Ausnutzung, doch ist er nach Célines Meinung eben nur die ›Fortsetzung der friedenszeitlichen Unterdrückung mit anderen Mitteln‹.
Hauptfigur in Célines Roman ist Ferdinand Bardamu, dessen Geschichte mit einem ganz persönlichen »August-Erlebnis« beginnt. Als junger Pariser Medizinstudent und schließlich Soldat im Ersten Weltkrieg, Kriegsneurotiker, Kolonialverwalter in Afrika, illegaler Einwanderer und später auch als Angestellter im US-Gesundheitssystem vagabundiert er durch die Welt. Zuletzt beendet er in Frankreich sein Medizinstudium und arbeitet zunächst als Armen-, dann als »Irrenarzt« und schließlich als Klinikchef in einem Pariser Vorort.
Bardamu verfügt von Anfang an über jenen misanthropischen Blick auf die Menschen, der ihm jedes noch so kleine Glück aufs Schnellste verleidet, weil er als fad und unecht durchschaut. Den Krieg durchleidet Célines Bardamu in ständiger Todesangst, getrieben zwischen dem »bisschen Sterben gehen« am Tag und der Schufterei im nächtlichen Feldlager, immer auf der Suche nach dem sich nie bietenden Ausweg. Als er sich schließlich gefangen nehmen lassen will, trifft er auf Robinson, der das gleiche Ansinnen hat und dem er in den folgenden Jahren immer wieder begegnen wird.
Nach dem Krieg bleibt Bardamu noch eine Zeitlang in Paris, flüchtet jedoch vor der Armut auf ein Schiff nach Afrika, um in den französischen Kolonien als Verwaltungsbeamter zu arbeiten. Doch in der Hitze des schwarzen Kontinents, stellt Bardamu fest, »zeigten die Weißen ihren wahren Charakter; er wurde dem entsetzten Beobachter völlig hüllen- und hemmungslos zur Schau gestellt. Man lernte die wirkliche Natur des Menschen kennen, so wie seinerzeit im Krieg.« In den Tropen offenbart sich der ganze Wahnsinn des kolonialen Unternehmens, schmelzen die versprengten Kolonialbeamten in der Hölle des Dschungels förmlich dahin; Bardamu flieht nach Amerika, gerät als Flohstatistiker in das Gesundheits- und Einwanderungssystem der Vereinigten Staaten und arbeitet für einen Hygienebeamten, der Mischief (zu Deutsch: Unsinn) heißt. Zurück in Frankreich beendet er sein Medizinstudium und praktiziert als von seinen Patienten geprellter und verachteter Armenarzt in Paris, bis er später in den Dienst einer »Irrenanstalt« eintritt.
Unter der Oberfläche der Zivilisation, so zeigt es Célines Roman, herrscht auch im Frieden noch Krieg und grausames Gemetzel, in dem Menschen erbarmungslos gegeneinander zu Felde ziehen. Für das Individuum bleibt als einzige Lösung, sich auf die richtige Seite der beiden Fronten zu bringen. Während Bardamu die Natur hasst, scheint er die Zivilisation noch weniger leiden zu können, denn den Eingeborenen ist z. B. »nur mit der Peitsche beizukommen«. Sie, so Célines Menschenverächter, hätten noch Stolz, während die Weißen durch Bildung bereits zum Gehorsam erzogen seien – eine Ausdeutung, die den europäischen Kolonialgedanken, der sich in der Pflicht zur ›Zivilisierung der Wilden‹ sieht, aufs Pessimistischste und Konsequenteste zu Ende denkt.
Céline, bürgerlich eigentlich Louis-Ferdinand Destouches, hatte bereits als Seuchenmediziner Karriere gemacht, als er mit »Reise ans Ende der Nacht« 1932 schlagartig berühmt wurde. Besonders in der Linken fand Célines Roman großen Zuspruch; in dem er größtenteils eine einfache, nämlich die Pariser Gossensprache nutzte, gab er dem Empfinden des (auch im Roman im Mittelpunkt stehenden) »Kleinen Mannes« der Unterschicht eine Stimme. Während die Reise noch als schonungslose und entlarvende Sozialkritik gelesen werden konnte, waren das 1936 erschienene Nachfolgewerk Tod auf Kredit und der im Folgejahr erscheinende Text Bagatelles pour une massacre (in Deutschland erschienen als Die Judenverschwörung in Frankreich) in wahllose Misanthropie und offenen Antisemitismus umgeschlagen. Auch politisch sympathisierte Céline offen mit dem Faschismus und war in das Vichy-Regime des Marschalls Petain verstrickt, weswegen er nach dem Krieg weitgehend aus dem intellektuellen Leben Frankreichs ausgeschlossen war. Er lebte bis zu seinem Tod 1961 in einem kleinen Ort in der Nähe von Paris und arbeitete als praktischer Arzt, vielleicht auch, weil er sich zeitlebens nie von seinen menschenverachtenden Ausfällen der Zwischen- und Vorkriegszeit distanzierte, sondern sich eher noch als seniler Verrückter gerierte. Wie weit der Hass bei Céline wirklich ging, wurde erst nach kurz nach seinem Tod durch die Veröffentlichung seiner Tagebuchaufzeichnungen klar.
Bei aller Verstrickung seines Autors in die Untiefen des Faschismus, dessen menschenverachtende Rhetorik und Denkweise großes Leid ausgelöst hat, bleibt Reise ans Ende der Nacht ein herausragender Roman. Die Reise ist kein klassischer Weltkriegsroman, die Beschreibung des Krieges und seiner unmittelbaren Folgen nimmt nicht einmal ein Viertel des Buches ein. Zugleich aber ist er doch der entscheidende Fluchtpunkt, dessen Perspektivlinien Bardamu auf seiner Flucht vor dem Leiden und der Angst in der Gesellschaft entdeckt, selbst fern jeder Zivilisation. Es gibt kein Entrinnen, »so wie im Krieg. Nichts geschieht. Niemand kommt und hilft.«
Offen aber bleibt die Frage: Ist die Menschheit so verroht, so eigennützig, so bestialisch, die Zivilisation kein Ausweg aus dieser Verrohung, sondern lediglich ihre Instrumentalisierung? Das ist sicher nicht ausgemacht; Zweifellos aber war Célines Roman ein Skandal, weil er die Grundgewissheiten der demokratischen Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts radikal in Frage stellte und sowohl den Kapitalismus als auch das Kolonialsystem und den Krieg in all seinen zweifelhaften Abgründen anprangerte. Céline entlarvt in diesem Roman alle humanen Bemühungen um Ordnung und Gerechtigkeit als »Mischief«, also als Unsinn, dem niemand wirklich entkommen kann – es bleibt nur diese eine grausame und zutiefst ungerechte Welt, in der man sich einrichten muss. Die Fragen, die der Roman damit aufwirft, haben auch heute nicht an Aktualität verloren. Sie sind eine Quelle der tiefen Melancholie geblieben, die Bardamu einmal so zynisch zusammenfasst:
»Ich war ja übrigens selber boshaft, alle Menschen sind es… Alles Übrige habe ich auf dem Wege eingebüßt, ja die Miene selbst, die man für Sterbende aufsetzt, auch die hatte ich verloren. Mein Gefühl ist einem Haus vergleichbar, in das man nur in den Ferien eintritt. Es ist kaum bewohnbar.«
90.0 MHz – Das hörst du! Das Bochumer Campusradio CT das radio und die fusznote kooperieren seit dem Sommersemester 2014
Veröffentlicht am 6. Februar 2015
von Anika Lehnert
Sie sitzen in den Untiefen der Ruhr-Universität Bochum. In einem Abschnitt, den kaum ein Germanistik-Studierender je zu Gesicht bekommen hat, oder von dem er auch nur weiß, dass jenseits der Mittelachse, in der die UB beheimatet ist, noch Leben existiert. Im Gebäude ICN liegen die Räume von CT das radio, dem studentisch geführten Radiosender für die Ruhr-Universität und die Hochschule Bochum, die Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe sowie die Technische Fachhochschule Georg Agricola. 24 Stunden non-stop sendet das älteste Campusradio in NRW für die Bochumer Studierenden und versorgt die Hörer nicht nur mit Musik, sondern auch mit allem Wissenswerten aus der Welt, der Umgebung und nicht zuletzt mit Neuigkeiten vom Campus. Wer täglich auf der Frequenz 90.0 MHz oder schlicht per Live-Stream im Internet zuschaltet, der ist mit der Sparte Fresschen sogar darüber informiert, was in der Mensa auf den Tisch kommt. In mehreren technisch ausgerüsteten Räumen sitzen jeden Tag die »Gesichter des Radios« aus allen Disziplinen der Universität beisammen und erarbeiten das Programm für den jeweiligen Tag. »Wichtig ist uns der studentische Bezug in den Beiträgen«, sagt Philipp Kressmann, Musikchef und Nachrichtenredakteur bei CT, »Natürlich berichten wir auch über wichtige Geschehnisse in der Welt, aber Neuigkeiten auf dem Campus sind für uns genauso wichtig – dafür sind wir ein Campusradio.«
Dass es gar nicht so einfach ist, einen Beitrag für das Radio aufzubereiten, hat die Redaktion der fusznote in mehreren kleinen Workshops persönlich erfahren. Unter der Anleitung von Philipp Kressmann und Ann-Kristin Pott, Programmchefin und Moderatorin, lernen wir unser germanistisches Wissen um den Aufbau eines »runden Textes« über den Haufen zu werfen und wieder bei Null anzufangen. Vergessen sollte man kunstvoll kreierte Haupt- und Nebensatz-Konstruktionen und den exzessiven Einsatz komplizierter Fachbegriffe. Reduktion ist das Stichwort! Denn das Ohr kann bei Weitem nicht so schnell Informationen erfassen wie das Auge beim Lesen eines Textes. »Bei einem Radio-Beitrag ist darauf zu achten«, so Ann-Kristin, »den Hörer direkt abzuholen.« Das heißt so viel wie: Der Hörer hört den Beitrag nur einmal und muss Schritt für Schritt an das Thema herangeführt werden, sonst schaltet er ab. »Besonders gut eignen sich auch bildhafte Formulierungen«, ergänzt Philipp noch, »denn so wird das Gehörte gleich viel lebendiger und leichter vorstellbar.«
CT das radio, dessen Name, so eine der Gründungslegenden, abgeleitet ist vom lateinischen »cum tempore«, das den Studierenden besser bekannt ist als das »akademische Viertel«, sendet seit 1997 aus Bochum und versteht sich selbst als Ausbildungs-Radio. Alle Studierenden sämtlicher Sparten haben die Möglichkeit sich dort zu engagieren. Der Einstieg erfolgt über ein halbjähriges Praktikum, das auch für den Optionalbereich angerechnet werden kann. Ebenso betreuen die Redakteure in dem großen Redaktionsraum mit unzähligen Rechnern Schüler, die im Rahmen des Praktikums Radioluft schnuppern wollen.
CT hat eine technische Reichweite von knapp 500 000 Menschen und bietet mit seinem größtenteils indielastigen Musikprogramm eine angenehme Alternative zu den großen Sendern. Doch kann das Radio in Hinblick auf das richtige Gespür für neue Trends den bekannteren Funkern durchaus das Wasser reichen. »Lange bevor aktuelle Interpreten wie Lykke Li mit ihrem Erfolgshit I follow Rivers oder Milky Chance mit Stolen Dance Standard wurden, hatte CT sie schon einige Monate im Programm«, erzählt Philipp, der verantwortlich für die Musikauswahl ist. Um zu vermeiden, dass Bands oder Interpreten schnell »totgespielt« werden, gibt es bei CT die Regel, dass ein Titel nicht zu oft am Tag gespielt werden darf. Mit den Sparten »Hörtest der Woche« und »Silberling der Woche«, die in Kooperation mit eldoradio* zustande kommen, wird darüber hinaus wöchentlich eine Neuerscheinung im Studio besprochen, die auf der Homepage auch in Rezensionsform nachzulesen ist. Doch nicht nur mit seinen vielseitigen Musiksendungen, die von den Campus-Charts über House und Reggae bis Metal reichen und zwischen 20 und 22 Uhr täglich variieren, bietet CT den Hörern ein abwechslungsreiches Repertoire. Auch kulturelle Tipps und Kritiken von Theateraufführungen oder Konzerten kommen im Programm nicht zu kurz. Insbesondere der Mittwochabend von 21 bis 22 Uhr bietet hierbei mit der Sendung »Kultimativ« allen Kulturfreunden Inspiration für die nächsten Abende.
Seit dem Sommersemester 2014 verbindet fusznote und CT das radio eine Kooperation. In regelmäßigen Abständen präsentieren die Redaktionsmitglieder der fusznote Neuerscheinungen aus dem Buchmarkt und liefern Anregungen für die nächste, nicht nur studentische Lektüre. Auch anstehende Lesungen oder Literaturfestivals werden vorgestellt, sodass Leseratten und vielleicht auch mancher vermeintliche Kulturmuffel etwas für seinen Geschmack findet.
In den Orkgruben von Mordor
Veröffentlicht am 26. Januar 2015
John Garth beschreibt in „Tolkien und der Erste Weltkrieg – Das Tor zu Mittelerde“ Jugend- und Kriegsjahre von J.R.R. Tolkien
von Britta Peters
Schreie in einer durchpflügten Schlammlandschaft, Feuer in systematisch angelegten, weit in die Erde hineinreichenden Gräben, Ungeheuerliches bringen sie an die Oberfläche, das die bekannte Welt mit Terror überzieht. Die Orkgruben von Mordor, Brutstätten der Armeen des Bösen, aus J.R.R. Tolkiens großer Fantasy-Trilogie um den Herrn der Ringe, sind nicht zuletzt dank der jüngsten Verfilmungen zum Membestand der Fan- und Popkultur geworden. Die komplexe Mythologie hinter den Heldengeschichten des Wissenschaftlers und Schriftstellers John Ronald Reuel Tolkien füllt eigene Bände, darunter neben Wörterbüchern und Legendarien Werke wie Rudolf Simeks Mittelerde. Tolkien und die germanische Mythologie (2005) oder der selbst zum Kultbuch gewordene Historische Atlas von Mittelerde (zuletzt 2012).
John Garth, britischer Journalist, Wissenschaftsautor und Tolkien-Kenner, hat sich zur Aufgabe gemacht, die Ursprünge von Tolkiens literarischer Arbeit neu zu beleuchten. Dazu hat er ein Korpus aus Kriegstagebüchern, Korrespondenzen und Zeitzeugnissen aus den Jahren vor und nach dem Ersten Weltkrieg ausgewertet, an dem Tolkien als britischer Fernmeldeoffizier teilgenommen hatte und der auch von ihm selbst als prägend für Elemente seiner Geschichten um die Fantasywelt Mittelerde genannt wurde. Dabei flossen in die Arbeit nicht nur Tolkiens eigene Notizen und Briefe ein, sondern immer parallel die seiner Vertrauten, Kollegen und auch anderen Teilnehmern der Somme-Schlacht, die, wie Garth zeigt, Tolkien tief geprägt hat.
Über 400 Seiten stark ist der Band, der sich als Beitrag einer »narrative history« versteht und dessen filmische Schreibweise streckenweise den Eindruck vermittelt, man habe es mit einem romanhaften Drehbuch zu »Tolkien – der Film« zu tun und nicht mit einer Monografie, die einen Bogen zwischen geschichtlicher Darstellung und philologischer Spurensuche spannt. Es ist spannende Lektüre, die Garth uns präsentiert, keine archivverliebte Zumutung. Darüber kann man geteilter Meinung sein und sich je nach dem eigenen Standpunkt im von Hans-Ulrich Wehler formulierten »Duell der gegenwärtigen Geschichtswissenschaft« auf Mythenjagd begeben oder analytisch orientiert die erzählerische Zurückhaltung fordern. Ein reines Übersichtswerk, dem rasch Daten und Wegmarken zu entnehmen sind, ist dieser Band nicht, wer mit ihm arbeiten will, wird schwer um eine vollständige Lektüre herumkommen. Garths Darstellungsform wird aber dem Gegenstand gerecht, der kein rein historischer ist und den er als organisch gewachsenes ästhetisches System einer literarischen »Mittelerde« auch aus philologischer Sicht analysiert.
Einen Schwerpunkt setzt der Band in den Jahren von Tolkiens später Schulzeit, Studienzeit und seiner Kriegsteilnahme. Die Materialfülle wird dabei so verarbeitet, dass Garths eigene Thesen sich in die Zeugnisse einbetten, die neben ausführlichen Briefzitaten auch Fotos und Karten der Tolkiens Militärdienst betreffenden Frontverläufe umfassen. Der Kriegsverlauf wird, soweit er den Schriftsteller als Soldaten betrifft, ausführlich geschildert, unterbrochen von Exkursen, darunter en passant eine Geschichte der Feen und Elfen im englischen Sprachraum. Für die interessiert sich nicht nur Tolkien, sondern auch seine Zeitgenossen, was für Garth zu einer paradigmatischen Verknüpfung zwischen Sagengestalt und Zeitgeist führt: »Die Feen hatten die gleiche Mission wie die TCBS und verfolgten sie mit denselben Mitteln«. Drei junge Männer sind Kernmitglieder dieses kreativen Clübchens namens »TCBS«, Tolkien, Christopher Wiseman, Rob Gilson. Sie verwalten ihre Schulbibliothek und nennen sich die »Tea Club and Barrovian Society«. Dann kommt als Vierter im Bunde der Freund Geoffrey Bache Smith dazu, Smith und Gilson werden im Ersten Weltkrieg sterben.
Garth führt in das Umfeld des werdenden Schriftstellers ein, Freunde, die Gruppe aus Gleichgesinnten, die sich gegenseitig ihre Pläne und erste lyrische Arbeiten präsentieren. Schritt für Schritt wird dann Tolkiens Kriegsteilnahme nachvollzogen, dabei immer in Beziehung gesetzt zu den Schicksalen der Jugendgefährten und seiner Frau Edith, der Tolkien seine Gedichte widmet und die ihm, wann immer er auf der britischen Insel stationiert ist, nachreist. Dabei stellt Garth einiges richtig, was in älteren Tolkien-Biografien kanonisch wurde, zum Beispiel das oft wohl zu dramatisch als schlecht dargestellte Verhältnis von Tolkien zu seinen militärischen Vorgesetzten in Frankreich. Viele von Tolkiens frühen Gedichten sind in den Kriegskorrespondenzen enthalten oder werden in Briefwechseln kommentiert und kritisiert. Garths Verdienst liegt auch darin, den Weg dieser zum Teil unpublizierten Arbeiten nachzuvollziehen und sie in eine Beziehung zu der sich auch während des Kriegs in Lazaretten und Wartezeiten entwickelnden Mittelerde-Mythologie zu setzen. Dabei schreckt Garth in seinen Analysen vor ästhetischen Bewertungen nicht zurück, bleibt aber vorsichtig, wenn es um Spekulationen bezüglich Tolkiens Motivation geht. Im Nachwort findet sich dann einiges an Parallelsetzungen, die über Tolkiens Selbstaussagen, die durchaus die Schrecken der erlebten Kriege mit den Schlachten um Mittelerde verknüpfen, hinausgehen. Garth räumt außerdem auf mit dem an Tolkien gerichteten Vorwurf des Eskapismus in eine Welt, die verdränge, was bei anderen Autoren seiner Zeit zu einem ernüchterten Realismus geführt hat. »Autoren wie Graves, Sassoon und Owen sahen den Großen Krieg als Krankheit an, Tolkien verstand ihn nur als Symptom.«, schreibt Garth, und: »Seine Faszination für das Elbenland ist kein Beweis dafür, dass der Erste Weltkrieg auf ihn keinen Einfluss gehabt hat, sondern vielmehr, dass die Faszination als Folge des Kriegs entstanden ist.«
»Sein Geist gleicht einem Lagerhaus« heißt es an weiterer Stelle über den jungen Tolkien, der viel später zeigen wird, dass es die Hallen von Moria sind, in denen er seine Schätze lagert. Wer einen biografischen Zugang zu Tolkiens Mythologie sucht, wird in Garths Monografie einen wertvollen Beitrag finden, der weit mehr als andere auf Fakten gestützt ist und sich trotz seiner Freude an der Narration mit Spekulationen zurückhält. Dabei ist allen, die wissenschaftlich an diesem Thema interessiert sind, die englische Ausgabe zu empfehlen, da die Übersetzung einen gekürzten Apparat aufweist und das englische Original inzwischen eine Überarbeitung erfahren hat.
John Garth: Tolkien und der Erste Weltkrieg. Das Tor zu Mittelerde. Klett-Cotta, 2014, 22,95 €. E-Buch 17,99 €.
Hörbuch des Monats Dezember
Veröffentlicht am 19. Dezember 2014
Das Nichts hat es bis unter den Weihnachtsbaum geschafft?
Der Weihnachtstipp: Die unendliche Geschichte ist als Hörspiel bei Hörbuch Hamburg erschienen
Pünktlich zu Weihnachten entführt uns Silberfisch, das Kinder- und Jugendprogramm des Hörbuch-Verlags Hörbuch Hamburg, mit einem ganz besonderen Hörspiel in das Reich der Phantasie und lässt damit Erinnerungen an Buchlektüren zu Kindheitstagen wieder erblühen.
Anlässlich des 35-jährigen Erscheinens von Michael Endes berühmter Unendlicher Geschichte ist in Zusammenarbeit mit dem WDR und den Erben Michael Endes ein aufwendig produziertes Hörspiel erschienen. Über 50 verschiedene Sprecher sind darin in über 70 Rollen beteiligt und erzeugen ein höchst atmosphärisches Hörerlebnis, das nicht nur junge Hörer begeistern dürfte.
Die Handlung kennen die meisten Hörer bereits von dem eigenen Leseerlebnis oder der mehr schlecht als recht gelungenen Verfilmung von Wolfgang Petersen aus dem Jahr 1984. Während der Film in vielen Details leider über alle Maßen enttäuschte, orientiert sich das Hörspiel am Original von Michael Ende. Darin hat der Glücksdrache Fuchur wieder glitzernde Schuppen statt weißes Fell, Atréju, der Held der Geschichte, blau-schwarzes Haar und grüne Haut und auch die gesamten Episoden mit Bastian in Phantásien sind aufgenommen worden. Bei wem das Buch bereits in Vergessenheit geraten ist, dem sei im Folgenden noch einmal kurz in Erinnerung gerufen, worum es genau geht:
Bastian Balthasar Bux, ein schüchterner Junge, der auf der Flucht vor den Schikanen seiner Mitschüler in einem Antiquariat Schutz sucht, entdeckt dort ein außergewöhnliches Buch: Die unendliche Geschichte. Er zieht sich auf den Dachboden seiner Schule zurück und versinkt in die Lektüre des Buches. Bastian taucht ein in das Reich der Phantasie und erfährt, dass die Kindliche Kaiserin, Herrscherin über Phantásien, sterbenskrank ist und schnellstmöglich ein Heilmittel für sie gefunden werden muss. Andernfalls würde das Land für immer durch das alles vernichtende Nichts zerstört werden. Auserkoren für die abenteuerliche Suche nach einer Heilung ist Atréju, ein junger Krieger, der alsbald erfährt, dass nur ein neuer Name für die Kaiserin Phantásien zu retten vermag. Bastian Balthasar Bux kann die Kaiserin retten – aber wie?
Alle Geschöpfe Phantásiens existierten nur durch das Dasein der Kindlichen Kaiserin. Ohne sie konnte nichts bestehen und so wurde sie von allen Geschöpfen dieses Reiches geschätzt und alle machten sich Sorgen um ihr Leben. Denn ihr Tod wäre der Untergang Phantásiens und gleichzeitig das Ende für sie alle.
Michael Endes Roman ist vor allem für seine philosophische Tiefgründigkeit bekannt, er ist ein Appell an die Bewahrung der kindlichen Phantasie auch im Erwachsenen-Alter. So verwundert es nicht, dass es gerade die „Mächtigen“ dieser Welt sind, die die Zerstörung Phantásiens beauftragen:
»Mächtige aus der Welt der Menschen, denen ich diene, haben die Vernichtung Phantásiens beschlossen, aber ihr Plan ist in Gefahr. Ihnen wurde berichtet, dass die Kindliche Kaiserin einen Boten ausgesandt hat, der ein Heilmittel für sie finden soll und damit auch für Phantasien.«
In der Unendlichen Geschichte lehrt uns Michael Ende, dass die Phantasie es ist, die uns vor der Traurigkeit in der Welt schützen kann. Wenn wir sie vergessen, bleibt nur das Nichts, das uns Stück für Stück die Freude am Leben raubt, wie es Atréju in den Sümpfen der Traurigkeit am eigenen Leib erfahren muss:
»So hast du noch nie geredet! Bist du krank?« – »Vielleicht … mit jedem Schritt, den wir weiter gehen, wird die Traurigkeit in meinem Herzen größer, […] geh alleine weiter, ich kann diese Traurigkeit nicht mehr aushalten.«
Das Hörspiel zur Unendlichen Geschichte, in der Bearbeitung von Ulla Illerhaus, erzeugt auf über 278 Minuten dank wandelbarer Sprecher und atmosphärischer Musik ein spannendes Hörvergnügen für Jung und Alt. Besonders hervorzuheben sind an dieser Stelle neben einer Vielzahl toller Stimmen Anna Thalbach und Hans Kremer als Erzähler und Laura Maire in der Doppelrolle als Kindliche Kaiserin und zauberhaftes Irrlicht. Obwohl die Hörspielfassung von Silberfisch und dem WDR 90 Minuten länger ist als die vorherige Bearbeitung vom Bayrischen Rundfunk aus dem Jahr 1981, wünscht man sich doch bei den letzten Klängen, der Titel des Romans möge Wirklichkeit werden und das Hörerlebnis andauern. Vielleicht wird Phantasie tatsächlich einmal Realität und sei es nur, in dem man bei CD 1 erneut beginnt.
Eine Hörprobe erhalten Sie hier.
Mehr Lieblingsbücher zu Weihnachten
Veröffentlicht am 14. Dezember 2014
Die letzte Woche vor dem Fest steht an, wer jetzt noch ohne Geschenke ist, ruht lang nicht mehr entspannt auf seinem Sofa. Zwei lesenswerte Schätzchen von 2014 besprechen wir daher last minute: „Dat Leben is kein Trallafitti“ von Otto Redenkämper, ein echtes Gutelaune-Buch – und „Länger als sonst ist nicht für immer“, ein einfühlsamer Roman von Pia Ziefle.
Otto Redenkämper: Dat Leben is kein Trallafitti
Wer kennt sie nicht, die Gardinen, die sich bewegen, nachdem man aus dem Auto gestiegen ist oder zur Mülltonne geht. Wer kennt nicht die Rentner, die alles im Blick haben, ob man will oder nicht. Der „Fenster-Rentner“ Otto erklärt uns die Welt, seine Kiosk-Welt in Gelsenkirchen und seine Inspektor-Buerlombo-Einsätze, bei denen er auf alles vorbereitet sein muss. So berichtet er in einzelnen Geschichten und auch von Schrecken am Morgen, wenn seine Frau Wilma die Lieblingsunterhemden nicht bereitgelegt hat oder die Schwimmbrille ins Wasser fällt. Das Leben eines Fenster-Rentners ist harte Arbeit, an dem Otto Redenkämper den Leser in seiner charmanten Art teilhaben lässt. Ruhrdeutsch ist die beherrschende Sprache, es finden sich Worte wie Kinners, Pilspalette oder Kinderplörre. „Trallafitti“ ist das vorherrschende Prinzip. So schreibt Otto: „Da war ja richtig Trallafitti bei euch. Du kennst ja das Sprichwort „Keine Power ohne Aua.“ Fenster-Rentner wissen über alles Bescheid und kontrollieren auch mal eine Biotonne, aber Ottos charmanter Art verzeiht man die Spionage und erhält einen amüsanten Eindruck vom Ruhrpottleben. „Glück auf!“ an alle Fenster-Rentner!
Kim Uridat
Otto Redenkämper: Dat Leben is kein Trallafitti. Der Fenster-Rentner erklärt die Welt. Fischer, 2014, 8,99 €. E-Buch 8,99 €.
—–
Pia Ziefle: Länger als sonst ist nicht für immer
Manchmal ist die Flucht alles, was noch bleibt, um sich vor dem Ersticken zu retten. Bleibt ein Kind dabei zurück, entwirft die Literatur gern Bilder von Schuld und Trauma, denn wer sein Kind den Wölfen überlässt, der kann kein Guter sein. Falsch, zeigt der zweite Roman von Pia Ziefle, und verspricht es schon im Titel. Länger als sonst ist nicht für immer handelt von einer Reihe elterlicher Fluchten. Fido mit dem vom serbischen Großvater verliehenen Namen, Ziefles liebenswerteste Figur, wird seine Mutter, die ihn als Baby weggab und sich ein wenig versteckt, besuchen. Ira, deren Mutter nicht in die Ferne, sondern ins Innere geflohen ist und sie zum Sündenbock für die Misere machte, wartet mit Job und Kind auf bessere Zeiten. Lew, den die Eltern beim Ausreiseversuch aus der DDR zurückgelassen haben, sucht seinen Vater am anderen Ende der Welt. In Indien wird er ihn finden und dort auch die Kraft schöpfen, von seiner eigenen Flucht zurückzukehren. Wohin, wird eine Überraschung sein. Ziefles Talent, auf Bösewichte zu verzichten, und denen Raum zu geben, die ihr Leben anpacken, überzeugte schon in ihrem Erstling Suna. Ihr neuer Roman entwickelt diese Haltung weiter und könnte man an Schriftsteller Bestellungen aufgeben, gälte eine sicher dem wilden Fido, der einen eigenen Roman bekommen sollte.
Britta Peters
Pia Ziefle: Länger als sonst ist nicht für immer. Arche Literatur Verlag, 2014, 19,99 €.
Neue Rubrik: Das Hörbuch des Monats!
Veröffentlicht am 28. November 2014
Die fusznote freut sich, eine neue Rubrik einführen zu können: Das Hörbuch des Monats! Fusznote-Redakteurin Anika Lehnert hört sich durch die Klangwelten der aktuellen Lesungen und Hörspiele und sucht interessante Highlights heraus!
Auch wenn der Dezember schon vor der Tür steht, wollen wir unseren Leserinnen und Lesern nicht die Empfehlung für November entgehen lassen: Wir waren furchtbar gute Schauspieler. Psychogramm einer Ehe vom Hörverlag.
Einen Höreindruck gibt es über den Link von randomhouse.
Die Kritik zu dem Hörbuch folgt hier:
Es gibt nur Platz für ein Talent in dieser Beziehung.
Das Psychogramm einer Ehe zwischen Scott und Zelda Fitzgerald
Wenn sein Buch zuerst erscheint und ich meins zu meiner eigenen Befriedigung schreibe, kann ich das doch, oder?! [Zelda Fitzgerald]
Wir schreiben das Jahr 1925: Francis Scott Fitzgeralds Roman The Great Gatsby erscheint und wird von den Kritikern begeistert aufgenommen. Fitzgeralds Meisterwerk zählt auch heute noch, knapp 90 Jahre später, zu den bedeutendsten Werken der amerikanischen Moderne. Genauso berühmt wie sein Roman gestaltet sich die Ehe zwischen dem Schriftsteller und seiner Frau Zelda, die geprägt ist von Alkoholeskapaden, Depressionen und Missgunst untereinander.
Einen Einblick in das Eheleben des berühmten Schriftsteller-Paares bietet der Hörverlag mit der inszenierten Lesung: Wir waren furchtbar gute Schauspieler. Psychogramm einer Ehe. Eindrucksvoll und authentisch gesprochen werden Fitzgerald und seine Frau von den Schauspielern Tobias Moretti und Birgit Minichmayr. Auf 2 CDs werden die Abgründe einer Ehe offenbar, die klar herausstellen, dass diese beiden Menschen in keine gemeinsame Zukunft blicken. Über 109 Minuten lauscht man den Worten eines egozentrischen Scott Fitzgerald, der den Anspruch erhebt alleiniger Schriftsteller in dieser Beziehung zu sein.
Doch wie kommt es zunächst einmal zu diesem dokumentierten Gespräch der Eheleute?
Am 28. Mai 1933 reist der Psychiater Dr. Thomas Rennie in die Siedlung Rodgers Forge in Maryland. Er besucht Scott und Zelda Fitzgerald in ihrer Villa namens „La Paix“. Zelda Fitzgerald wird zu dieser Zeit bereits seit drei Jahren psychiatrisch betreut. Ihre Angst- und Erschöpfungszustände rühren nicht wenig wahrscheinlich von den andauernden Eheproblemen. Scott Fitzgerald ist hingegen seit geraumer Zeit schwerer Alkoholiker, sieht dies jedoch nicht als Ausgangspunkt der Eskapaden zwischen ihm und Zelda. So legt er doch nahe, er tränke nie vor dem Frühstück! Mit dem Alkoholmissbrauch verbunden ist eine Schaffenskrise des Schriftstellers, an der er jedoch Zelda die Schuld gibt. Durch ihre psychischen Probleme und die daraus resultierende Pflicht seinerseits, ihre Krankhausaufenthalte zu finanzieren, halte Zelda ihn davon ab, seinen nächsten großen Roman zu beenden. Besonders Zeldas Wille, einen eigenen Roman zu schreiben, begrüßt Scott Fitzgerald wenig und untersagt ihr deutlich, dies vor der Veröffentlichung seines eigenen Buches zu tun. Am liebsten wäre es ihm, wenn Zelda gänzlich das Schreiben unterlassen würde um so nicht seinem Ruf als Schriftsteller zu schaden. Um Zeldas Vorhaben einen Roman zu schreiben, unterbinden zu können und ihr Versprechen dem gegenüber dokumentieren zu können, protokolliert der von Scott Fitzgerald herbeigerufene Psychiater Dr. Rennie die Unterhaltung der beiden Klienten. Während der Psychiater streng genommen die Sitzung lediglich moderieren sollte, werden seine Einwürfe immer parteiischer bis er Zelda dazu bringt, ihrem Mann zu versprechen, ihren geplanten Roman nicht vor Veröffentlichung des seinigen fertig zu stellen. Gesprochen wird Dr. Rennie in der inszenierten Lesung von Regisseur Lutz Hachmeister.
Also für diesen Zeitraum ist Mrs. Fitzgerald bereit Alles zuzugestehen und ich glaube, Sie sollten alle weiteren Diskussionen vertagen bis das geschehen ist. Bis der Roman beendet ist, wird sie Alles zugestehen und wenn Sie mehr als das verlangen, verlangen Sie mehr als die meisten Menschen geben würden, weil danach ihre Sicherheit sehr davon abhängt, was Sie tun werden. Eigentlich verlangen Sie lebenslange Sicherheit, was eine ganze Menge ist. [Dr. Rennie]
Mit „Wir waren furchtbar gute Schauspieler“ ist dem Hörverlag ein hoch interessanter Blick hinter die Kulissen der Goldenen 1920er Jahre geglückt. Sowohl Birgit Minichmayr als auch Tobias Moretti erzeugen ein authentisches Bild des Schriftstellerpaares Fitzgerald. Moretti unterstreicht die egozentrische, alles dominierende Art Scott Fitzgeralds, während Minichmayr als Zelda stets ihrem Mann unterlegen ist, doch nie aufgibt für sich und ihre freien Entscheidungen zu kämpfen.
Es ist etwas, das ihre Bücher daran hindert gut zu sein, weil sie ein und dasselbe immer und immer wieder tut. […] Im Moment leben wir, sie und ich, in einer bourgeoisen Welt unter bourgeoisen Bedingungen und wie wir das tun, das ist sowas von komisch. […]Ich weiß nicht, wie viel ich noch verkraften kann? Ich bin am Ende meiner Kraft und viel länger kann ich so nicht weitermachen. [Scott Fitzgerald]
Das Hörbuch inszeniert das Eheprotokoll als spannendes Originaldokument, wenngleich es beim Hören Aggressionen gegenüber dem begabten, doch gleichzeitig destruktiven Schriftsteller schürt und den Schritt erschwert, jemals noch einmal Scott Fitzgeralds „The Great Gatsby“ zur Hand zu nehmen.
Rezension: Esel. Ein Portrait von Jutta Person. (Naturkunden) – Matthes & Seitz, 2013.
Veröffentlicht am 30. März 2014
Vom Adel der einfachen Herzen. Jutta Person erzählt mit Sachverstand und Witz vom Eselstreiben durch die europäische Literatur und Geistesgeschichte
von Britta Peters
„Leider wissen wir nicht, was Schlegel, Novalis oder Tieck über den Esel gedacht haben. Er hätte aber ein wunderbares Wappentier abgegeben für alle, die den Schweinsgalopp des immer effizienten Handelns zu unterlaufen versuchen. Durch Stehenbleiben.“
Wenn wir über Esel sprechen, können wir über uns selbst sprechen. Über “moderne Stehenbleiber”, Zauderer und Indolente, die anthropologischen Irr- und Umwege erhoffter Wissensbildung durch die Physiognomik. Über ein Nutztier, das ökonomisch an Bedeutung verliert und doch in vielen Teilen der Welt unverzichtbarer Begleiter des Menschen bleibt. Jutta Person geht in Esel – ein Portrait den Spuren nach, die der Esel in der europäischen Literatur hinterlassen hat. Sie sichtet frühneuzeitliche naturkundliche Beschreibungen, die immer auch das Eselsbild aus der Antike aktualisieren, literarische Texte und besucht in Süddeutschland einen Eselzüchter und seine Herden.
Es ist bemerkenswert, dass es Esel sind, deren Weg durch unsere Literatur sich die Berliner Philosophin, Kulturwissenschaftlerin und Literaturkritikerin einmal genauer ansieht. In ihrem Essay, der zu einer Reihe von “Naturkunden” gehört, trägt Person unterhaltsame und denkwürdige Fundstellen zusammen. Und die haben es in sich: Da ahnt hundert Jahre vor Darwin ein Vergleich zwischen Pferd und Esel die Evolutionstheorie voraus. Das “verbotene Esel-Pferd-Gedankenspiel” schafft Freiraum, auch über Mensch und Affen nachzudenken – natürlich, ohne die Zensur zu verärgern, alles bleibt fiktiv. Und doch trottet der Esel, dem Pferd seltsam ähnlich, allem statthaften Denken durch’s sorgfältig angelegte Beet…
Während sich heute geradezu panische Abgrenzungsbemühen gegen den jeweils Anderen durch unsere Gesellschaft ziehen, wird die Erinnerung an einen unserer ältesten Kulturbegleiter zum wertvollen Dokument. Persons Essay zeigt uns am Beispiel des Esels, wie Distinktion unsere Geistesgeschichte prägt, und wie sehr selbst ein Tier mit der Interpretation seiner echten und vermeintlichen Eigenschaften in Wissenschaft und Literatur als Projektionsfläche dienen kann. Wo preisgekrönte Schriftstellerinnen mit medizinischer Unterstützung gezeugte Kinder ungeniert als “Halbwesen” bezeichnen, denen der Adel einer gesegneten Zeugung und Geburt abgehe, erinnert Person daran, dass der Jesus der Evangelien auf einem Esel in Jerusalem einzog und damit auf das edlere Pferd verzichtete. Dabei ist der mit 144 Seiten kurze, mit etlichen Abbildungen versehene Text beileibe nicht moralinsauer oder trocken, sondern ausgesprochen unterhaltsam. So sehen wir unter anderem Schiller, der in lässiger Hipsterpose auf einem Esel reitet, kuriose Halbwesen (ja, auch die!) und erfahren die Namen der Mischlinge zwischen Eseln, Pferden und Zebras.
Und was haben eigentlich der antike Autor Apuleius, Shakespeare und Nick Cave gemeinsam? Richtig, sie lassen auf die ein oder andere Weise Esel durch ihre Bücher traben. Der Esel, Kind unsicheren Terrains und felsiger Gebirgslandschaften, flieht nicht, wenn er in Gefahr ist. Instinktiv weiß er, dass rasende Flucht ihm die Beine bräche, also bleibt er stehen und lässt die Dinge an sich herankommen. Wehren kann er sich immer noch, wenn es brenzlig wird, und vielleicht naht ja auch ein Freund mit ein paar Möhren in der Tasche. Denn: “Etwas besseres als den Tod finden wir allemal”. Das stellt der Esel der Bremer Stadtmusikanten fest, was Person ausgesprochen modern findet. Das Stehenbleiben ist in der Tat modern in einer Welt, in der das Fluchtmodell des Pferdes nicht in die Freiheit, sondern auch nur anderswo ins globalisierte Überall führen muss.
Jutta Persons humorvoller Essay im standesgemäß grauen Flauscheinband ist ein kleines Schmuckstück. Er unterhält intelligent, gibt dabei Anreize, sich manche der vorgestellten Texte einmal selber vorzunehmen und er regt an, über ein Modell des sanften Widerstandes nachzudenken. Das andernorts in die Katastrophe führende, beim Esel durch gute Behandlung vorübergehende “I prefer not to” ist nicht nur Ärgernis für seinen Treiber, es ist womöglich auch ein Angebot. Denn nicht nur für Meister Langohr gilt: “Was aber auffällt, ist die Erklärungsnot, die der tierisch Duldsame quer durch die Jahrhunderte bei seinen menschlichen Herren provoziert. Je gleichmütiger der Passive die Schläge einsteckt, desto fragwürdiger scheint dem Aktiven die eigene Aktivität zu werden.”
Wer eine Anleitung zum Umgang mit seinem Haustier sucht, wird in Persons Esels-Buch nicht fündig. Wer sich aber eine Weile zu anregender und geistreicher Lektüre zurückziehen will, ist mit diesem literarischen Tierportrait ausgezeichnet beraten.
Jutta Person: Esel. Ein Portrait. Matthes & Seitz, 2013, 18 €.
« Ältere EinträgeLetzte Artikel
- Teil der Lösung – Plädoyer für ein bedingungsloses Grundeinkommen
- Stillstand ist der Tod: In Thomas Lehrs Roman "42" steht die Zeit still – und quält den Protagonisten
- Hate Radio
- Heimat im Ruhrgebiet Poetry Slammer berichten über den Ort, für den ihr Herz schlägt
- Über das Ruhrgebietsdeutsch
Archive
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Mai 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013