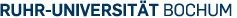
Neugermanistik III (Prof. Dr. Nicola Kaminski)
insbesondere deutsche Literatur von der Frühen Neuzeit bis zum 18. Jahrhundert
Germanistisches Institut an der Fakultät für Philologie
Dissertationen
Verena Börder
Simplicissimus als Autor: narrative Manipulationsstragien im Keuschen Joseph
In seinem handschriftlichen Nachlass verliert Gotthold Ephraim Lessing einige kurze Worte zu dem Verfasser des Simplicissimus Teutsch: »Greifenson, (Samuel), aus Hirschfeld, lebte im vorigen Jahrhunderte, und war in seiner Jugend Musketier. Mehr ist nicht von ihm bekannt, ob er gleich verschiedenes geschrieben hat, nehmlich: Den Simplicissimus, einen zu seiner Zeit beliebten Roman, welchen er anfänglich unter dem versetzten Nahmen German Schleifheim von Selsfort [sic] heraus gab, und der mit einigen fremden Arbeiten, zu Nürnberg, 1684, in zwey Theilen in 8, wieder aufgelegt ward.« Lessing erkennt aus zeitgenössischer Perspektive Samuel Greifnson vom Hirschfeld als den tatsächlichen Autor der aufgeführten Werke, nimmt also die Herausgeberschaft rund um den Beschluss des Simplicissimus Teutsch nicht als erfunden wahr, sondern für bare Münze. In diesem Anhang erklärt ein nur in Abbreviatur auftretender H.I.C.V.G.P. zu Cernheim, dass die soeben gelesene Autobiographie aus der Feder eines gewissen Samuel Greifnson vom Hirschfeld stammt, der ebenso als Autor des Keuschen Joseph und des Satyrischen Pilgram hervorgetreten ist. Das Verhältnis zwischen Simplicius Simplicissimus und seinem Verfasserpseudonym Samuel Greifnson vom Hirschfeld ist indes komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint, wenn man berücksichtigt, dass die genannten Werke auch innerhalb der Erzählung aufeinander verweisen. So wird der Keusche Joseph von Simplicius Simplicissimus explizit in Buch IV und V des Simplicissimus Teutsch als Eigenwerk angesprochen − die Autorfiktion des autobiographischen Erzählens geht also soweit, dass der Erzähler weitere Werke als sein Eigen ausgibt und so auf Metaebene das Werkcorpus erweitert. Dies wirft die Frage auf: Wieviel Simplicissimus steckt im Keuschen Joseph? Es fällt auf, dass auch hier der Erzähler lückenhaft berichtet. Die Weigerung, Ereignisse und Begebenheiten ausführlich zu beschreiben, ist dabei nicht als bloßes Kürzungsverfahren abzutun, sondern eine zielgerichtete narrative Ausweichstrategie, die den Leser dazu verführt (ganz wie im Simplicissimus Teutsch), die göttliche Vorsehung und das unsichtbare Handeln unkritisch als gegeben wahrzunehmen. Dem Leser wird über eine vermeintlich sinnstiftende, der biblischen Didaxe verpflichteten Erzählung suggeriert, Teil eines offenliegenden Prozesses zu sein; in Wirklichkeit − so meine Theorie − ergibt sich durch das narrative Spinnennetz eine Vielzahl an Fallstricken, die in Verbindung mit der vom (fiktiven) Autor gezielt etablierten Traummetaphorik das transparente Ziel einer auktorialen conversio ad deum fraglich werden lassen. Wenn der Autor in der Person von Samuel Greifnson vom Hirschfeld es sich zur Aufgabe macht, den biblischen Stoff nach seinem Ermessen zu verändern und zu erweitern, bedient er sich nicht nur einer symbolisch-allegorisch aufgeladenen Sprache, sondern akzentuiert auch den hermeneutischen Verstehens- und Deutungsprozess. In der Bereitschaft und fraglosen Gewissheit, das eigene Handeln und Tun unter dem Willen Gottes zu sehen, im sicheren Glauben, gottnah zu agieren, finden Protagonist und Erzähler im Keuschen Joseph ihre Gemeinsamkeit. Der kommentierende und reflektierende, das Geschehen regelmäßig mit satirischen Momenten anreichernde Erzähler wählt diese biblische Geschichte jedoch nicht nur ihrer Bildlichkeit oder Aussagekraft wegen, sondern auch darum, um ein Stück seiner selbst darzustellen, eine Art metasubjektive Ich-Spiegelung, die sich im gesamten Text wiederfindet. Die Dissertation soll aufzeigen, dass die neu eingeführten Inhalte und die doppelte Projektion auf die Figur Josephs unter dem Motto der göttlichen Vorsehung somit Teil der Darstellungsintention eines fiktiven, manipulierenden Autors sind.
Marina Doetsch
Konzeption und Komposition von Gottscheds Deutscher Schaubühne (abgeschlossen Januar 2016)
Üblicherweise wird die Deutsche Schaubühne als Sammelwerk ohne kompositorische Dimension dargestellt, daher ist es ein neuer Ansatzpunkt, dass die Deutsche Schaubühne als eine Komposition auf der Grundlage einer Konzeption betrachtet wird. Dieses Projekt soll deshalb dabei helfen, ein Forschungsdesiderat zu erarbeiten und eine Blickveränderung auf dieses Korpus leisten, da die Forschung in Bezug auf die Deutsche Schaubühne, in der von Lessing mit dem 17. Literaturbrief begründeten Tradition, abwertend und negativ urteilt.
Die Deutschen Schaubühne (1741-1745) befindet sich in einem Spannungsverhältnis, da sie einerseits praktisch die theoretische Grundlage der Critischen Dichtkunst umsetzen und deutsche regelmäßige Tragödien und Komödien abbilden soll und da sie andererseits kompositorische Brüche aufweist und Verstöße gegen die sog. Gottschedsche Regelpoetik enthält. Diese kompositorischen Brüche beginnen bereits damit, dass die sechs Bände nicht in der logischen Reihenfolge erscheinen. Noch offensichtlicher wird die Brüchigkeit, wenn man in den Aufbau der einzelnen Bände und der einzelnen Dramen schaut, da die von Gottsched vorgegebenen Regeln vielfach missachtet werden. Daran knüpft sich die Ausgangsthese an, dass diese Brüche beabsichtigt sind und dass sie eine kritische Auseinandersetzung mit der Tragödie und der Komödie zeigen, da diese Gattungen nicht regelkonform umgesetzt werden können, ohne Defizite auf der dramaturgischen oder moralischen Ebene aufzuweisen. Es schließt sich die Frage an, inwiefern Gottscheds Absichten innerhalb der Deutschen Schaubühne umgesetzt wurden und welche kompositorische Folgen sich daraus ergeben.
Mirela Husić
Von Pergamentrollen, Gemälden, Lederbüchern und versiegelten Päckchen: Stifters Scharnasterzählungen im Zusammenspiel von Zeitschrift, Zeitung, Taschenbuch und Buchmedium
Als Adalbert Stifters »Die Mappe meines Urgroßvaters« zwischen dem 3. und 12. Juni 1841 in der Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode als Fortsetzungsgeschichte abgedruckt wird, weiß die Leserschaft noch nicht, dass die am 12. Juni als »Schluß« angezeigte Lieferung nicht die letzte der »Mappe« bleiben soll, sondern zwei weitere Lieferungsblöcke im September desselben Jahres und März des darauffolgenden nach sich zieht, gemäß den erzähllogischen Implikationen des als Herausgeber und Editor fungierenden Ich-Erzählers, der ankündigt, weitere Schriften seines Urgroßvaters Julius Scharnast folgen zu lassen, sobald er diese selbst gelesen und »nachdem [er] sie vorher übersetzt und unserer Zeit verständlich gemacht« habe (Wiener Zeitschrift, 3.6.1841). Das in dieser Weise die Machart der Zeitschrift reflektierende, offen und seriell angelegte Projekt des Ich-Erzählers findet keinen Abschluss in der Wiener Zeitschrift: Im Herbst 1842 erscheint in dem bei Gustav Heckenast in Pesth verlegten Taschenbuch Jris Stifters Erzählung »Narrenburg«, die anders als die »Mappe« nicht die bürgerliche Seitenlinie der Scharnastfamilie, sondern den adligen Stamm und seine Schreib- und Lesetradition fokussiert, die die genealogische Linie sichern soll, doch diese erst recht einem möglichen Abbruch aussetzt.
Dieses ›wiederholte‹, serielle Erzählen des scheinbar gleichen Konflikts wird in vier weiteren Erzählungen um die Scharnastfamilie im Pesth der 1840er Jahre auf einem literarischen Markt, der durch mediale Vielfalt und die damit einhergehende Konkurrenz und Interaktion zwischen diesen Medienformaten gekennzeichnet ist, fortgesetzt, variiert, und unterbrochen. Die Erzählungen reflektieren dabei zugleich die jeweilige charakteristische Materialität, das visuelle Design und die einer spezifischen temporalen Logik folgende Erscheinungsweise der einzelnen Medienformate (Zeitschrift, Taschenbuch, Zeitung, Buch), so dass die brüchige Linie der Scharnastgenealogie mit der Kohärenz und gleichzeitigen Brechung der Erzählungen Stifters zusammenläuft, diese gar immer wieder ausstellt.
Die Engführung von Schreib- und Leseakt zwischen Rahmen- und Binnennarration wirft Fragen von Autorschaftskonzeptionen und deren Inszenierung, von Produktions-, Distributions- und Rezeptionsbedingungen und -relationen auf, die sich vor dem Hintergrund einer sich ausdifferenzierenden Medienlandschaft in einer Komplexität entfalten, die traditionellen Konzeptionen von Werk und Autor zuwiderlaufen. Der Wechsel von Wien nach Pesth, vom Bürgertum zum Adel, von Gegenwart zur Vergangenheit ruft zugleich weitere Diskurse auf, die nicht nur innerhalb der jeweiligen Diegese Schauplätze, Handlungsverläufe und Charaktere bestimmen, sondern auch in den Medien des Vormärz zwischen Wien und Pesth virulent werden, etwa Fragen der sozialen, familialen, ethnischen und nationalen Zugehörigkeit, damit einhergehend Geschlechter-, Kolonial-, Genealogie- oder Modediskurse.
Das Erkenntnisinteresse des Dissertationsprojekts zielt auf genau dieses Zusammentreffen unterschiedlicher Medienformate und die sich daraus entspinnenden Momente von Verbindungen und Brüchen. Im Unterschied zur bisherigen Forschung, die vor allem die Einzelerzählung und speziell die »Mappe« bevorzugt wahrnimmt, sollen alle sechs Scharnasterzählungen, die zwischen 1841 und 1847 erscheinen, dezidiert innerhalb ihres jeweiligen Publikationsorts untersucht werden.
Stefanie Junges
Oszillationsmomente in der Literatur der Romantik (abgeschlossen im Dezember 2018)
Die Literatur der Romantik umfasst viele Autoren und Werke, wurde von der Forschung in verschiedene Phasen differenziert und gilt bis heute als unübersichtlich und ambivalent. Das Dissertationsprojekt knüpft an diesem Punkt an und untersucht mithilfe des Oszillationskonzeptes diese vermeintlich ambivalenten Strukturen. Das Phänomen der Oszillation (von lat. oscillatio – das Schaukeln) ist im literaturwissenschaftlichen Kontext vorrangig im Sinne von ›Grenzaufhebungen und -überschreitungen‹ bzw. im Sinne des Verschwimmens von Grenzen zu verstehen und wird auf drei verschiedenen Ebenen untersucht. Dabei sind sowohl textimmanente ›Grenzübertretungen‹ inbegriffen, wie das Transzendieren von Figurenrealität und einem Reich der Phantasie oder des Wunderbaren, als auch formale Überschreitungen innerhalb und außerhalb eines Textes – gemeint sind damit nicht allein Gattungsinterferenzen oder narratorische Besonderheiten des Textes, die ein Differenzieren unterschiedlicher Sphären erschweren, sondern auch intertextuelle Verweise auf andere Werke der Epoche der Romantik. Nicht nur das Oszillieren zweier (oder mehrerer) Welten, sondern auch ihr individuelles, dynamisches Spannungsverhältnis und dessen Wirkung auf Handlung, Figuren und Leserrealität, sollen in exemplarischen Analysen der einzelnen Texte berücksichtigt werden.
Die Grundannahme der Dissertation ist dabei, dass das Phänomen der Oszillation zwangsläufig aus der sogenannten ›romantischen Programmatik‹ hervorgeht. Die Romantiker wehren sich gegen jegliche Form der Kategorisierung und Klassifizierung und betrachten Literatur als unbegrenzte, unendlich fortschreitende Einheit (›progressive Universalpoesie‹). Das Brechen mit Konventionen, das ›Vernetzen‹ von Welten und das Überschreiten von Grenzen manifestieren sich in der romantischen Literatur selbst.
Ausgehend von basalen romantischen Schriften, wie dem Athenaeum, soll erarbeitet werden, was genau die ›romantische Idee‹ beinhaltet, um dies durch Einzelanalysen vor dem Hintergrund der Oszillationsmomente an ausgewählten Werken der Romantik nachzuvollziehen. Die Arbeit versucht nicht nur inhaltlich (z.B. durch den Verzicht auf die Differenzierung von ›literarisch‹ und ›theoretisch‹), sondern auch formal dem ›rebellischen‹ Gestus der Romantiker gerecht zu werden und orientiert sich daher im Aufbau an Romanstrukturen.
Benjamin Kozlowski
›Prosaekloge‹ vs. ›Schäferei‹ – gattungspoetologische Gedanken zur deutschen Bukolik des 17. Jahrhunderts im europäischen Kontext
Mit der Schäfferey von der Nimfen Hercinie (1630) schuf Martin Opitz ein Modell der Schäferdichtung in Prosa, das fortan modellbildend für die deutsche Bukolik des 17. Jahrhunderts werden sollte. Trotz vereinzelten Forschungen zu prominenten Texten der deutschen Prosabukolik, insbesondere der Hercinie, stellt eine Gattungsgeschichte nicht nur der so genannten ›Prosaekloge‹, sondern der deutschen Bukolik in Prosa des 17. Jahrhunderts überhaupt, derzeit noch ein Desiderat dar. Diese Lücke vor allem in gattungspoetologischer Sicht zu füllen, nimmt sich diese Arbeit vor. Der erste Teil stellt eine klassische Gattungsgeschichte der so genannten ›Prosaekloge‹ dar. So wird zunächst die Genese der Hercinie aus der modischen, romanischen Prosabukolik verfolgt werden, die seit der Etablierung des Gattungsbegriffs ›Prosaekloge‹ vollständig aus dem Blickfeld der Forschung verschwunden war. In der anschließenden Darstellung der Entwicklung von 1630 bis etwa 1690 werden das Ausloten der Möglichkeiten der ›Gattung‹ in den frühen Imitationen (Finckelthaus, Fleming und von Rosenthal/Zesen) wie auch die Vereinnahmung der Gattung durch die Mitglieder des Pegnesischen Blumenordens, insbesondere Sigmund von Birkens und seiner Nachahmer, untersucht. Abschließend wird das durch neue literarische Modelle und Kritik an den Sprachgesellschaften ausgelöste Ende der Gattung diskutiert. Nach dieser klassischen Gattungsgeschichte wird im zweiten Teil über die bukolischen Gattungen in zeitgenössischer Sicht reflektiert werden. Insbesondere die im ersten Teil als selbstverständlich hingenommene Vorstellung einer Gattung ›Prosaekloge‹ soll dabei in Frage gestellt werden. Einem solchen wohldefinierten und eindeutigen Gattungsverständnis widerspricht u.a., daß die Prosa zunächst zwar gar nicht poetologisch vorgesehen ist, sie andererseits aber, vermittelt über die Metagattungen Bukolik und Gelegenheitsgedicht (bzw. Lobgedicht, Hochzeitsgedicht u.a.), gleich mehrfach definiert ist. Auch als sich die Poetiken der Prosa öffnen, herrscht kein Einklang: sie wird sowohl als ›Ekloge in Prosa‹ wie auch als ›eine Art Roman‹ definiert. Um Licht in diesen Dschungel zu bringen, wird das poetologische Material in erster Linie aus den Texten selbst systematisch gehoben und ausgewertet werden: den Gattungsbezeichnungen in den Titeln, gattungspoetologischen Äußerungen in den Vorreden, Widmungsadressaten u.ä. Da, wie die französischen Poetiken der Zeit zeigen, der poetologische Problemfall ›Prosa‹ ein europäisches Phänomen ist, wird die Arbeit dabei auch die poetologische Diskussion über Prosa und Bukolik in den europäischen Nachbarländern, insbesondere Frankreich, im Blickfeld behalten.
Nora Ramtke
›Falsche‹ Wander- und Meisterjahre. Verhandlungen um Autorschaft und Anonymität in der späten Goethezeit (abgeschlossen Februar 2015)
1821 verursachen Wilhelm Meisters Wanderjahre einen veritablen Literaturskandal: das Werk erscheint zweifach. Zur Beruhigung aller Beteiligten klärt sich der Fall schnell, die einen Wanderjahre waren mit dem Namen ›Goethe‹ versehen, die anderen eine anonyme Publikation. Das Urteil war schnell gefasst, und die beiden Werke gleichen Titels in ›falsche‹ und ›echte‹ Wanderjahre unterschieden. Vor dem Hintergrund dieses so klaren Urteils muss es verwundern, dass die anonymen Wanderjahre ihr Prädikat ›falsch‹ durchaus nicht akzeptieren wollen und offen bezweifeln, ob ausgerechnet der Autorname genau diese Unterscheidung zu leisten vermag. Diesem Zweifel soll in dem geplanten Dissertationsprojekt nachgegangen werden, denn so abwegig er zunächst scheinen mag, rührt er doch an die grundlegenden literaturwissenschaftlichen Fragen ›Was ist ein Autor?‹ und ›Was ist ein Werk?‹ und spezieller: Wie lässt sich die Herrschaft des Autors über (s)ein Werk begründen? Im Zentrum des Interesses stehen daher auf der einen Seite die Exklusionsmechanismen, die Goethe zum einzig legitimen Verfasser von Wilhelm Meisters Wanderjahren machen und so für einen an personale Autorschaft gebundenen Werkbegriff stehen; auf der anderen Seite soll ein besonderes Augenmerk auf die Anonymität gelegt werden, welche auf eine aus sich selbst, d.h. aus dem Text begründete Vorstellung von ›Werk‹ abzielt und somit die werkkonstitutive Funktion des Autors zurückdrängt. Es zeigt sich, dass die doppelte Existenz von Wilhelm Meisters Wanderjahren, bzw. ihre Unterscheidung in ›richtige‹, d.h. autorisierte, und ›falsche‹ Wanderjahre, einem Angriff auf die in Kategorien von Eigentum gedachte Autor-Werk-Beziehung gleichkommt. Angelegt ist das Promotionsvorhaben als Fallstudie, die sich nicht in der Nachzeichnung des Literaturskandals erschöpfen soll, sondern das provozierende Moment der ›falschen‹ Wander- und Meisterjahre im Hinblick auf die Frage nach Autor und Werk sowie deren Verhältnis zueinander ernst nehmen will.
Sven Schöpf
Über die Machart des Trauerspielbuchs. Kontextualisierung des Benjaminschen Barockwerks
In seiner materialphilologisch ausgerichteten und historisch orientierten Erstausgaben-Exegese von Ursprung des deutschen Trauerspiels (1928) unternimmt Sven Schöpf den Versuch, anstatt – wie es seitens der »ausgeuferten Benjaminphilologie« (Jauß) üblich ist – den ›ganzen Benjamin‹ oder dessen ›Denken in nuce‹ erheischen zu wollen, das ›ganze Trauerspielbuch‹, d.h. neben dessen ›Inhalt‹ auch die typographische Gestaltung der Erstausgabe sowie den wissenschaftsgeschichtlichen ›Ursprung‹ des Benjaminschen Barockwerks, zu erörtern.
Einen zentralen Aspekt des Dissertationsprojekts bildet die Einsicht, dass die Drucklegung des Trauerspielbuchs in einer barocker Auszeichnungsschrift (Alte Schwabacher) eine semantische Reziprozität zwischen Barockwerk und dessen barockem Sujet zeitigt, die durch die »Gewalttat des Gleichmachens« (Adorno), die Œuvre-orientierter Editionsphilologie symptomatisch eignet, konterkariert wird und eine ›positivistische‹ Lesart des Barockbuchs forciert, die dem nachweislich als solches konzipierten ›Kunstwerk‹ nicht gerecht wird.
Neben einer Analyse des hermeneutischen Potentials der Gehalt/Gestalt-Korrelation, die die Erstausgabe ›auszeichnet‹, wird außerdem erstmals der Versuch unternommen, das Barockwerk als Teil des fachwissenschaftlichen Diskurses, dem es zeitgenössisch ›entspringt‹, ernst zu nehmen und dessen allgemein anerkannte ›Sonderstellung‹ nicht aufgrund von Benjamins Polemik gegen den literaturwissenschaftlichen Betrieb seiner Zeit (»Die heutige Germanistik ist eklektisch, das will sagen, durch und durch unphilologisch« und »[d]er geile Drang aufs große Ganze ist ihr Unglück«) unhinterfragt zu übernehmen, oder vor der Autorität der »Chiffre im akademischen Diskurs« (Pethes) unreflektiert in die »Haltung der Proskynese« (Schings) zu verfallen.
Von entscheidender Bedeutung für die Studie ist zudem eine intensive Auseinandersetzung mit den dem Ursprung des deutschen Trauerspiels ›eingeschriebenen‹ barocken Quellen, die als Scharnier einerseits der Genese einer kunstphilosophischen ›Inszenierung‹ dienen, andererseits den ›wissenschaftlichen Anspruch‹ des Barockwerks fundieren.
Robert Schütze
Zur Geschichte der Fiktionalität in der Frühen Neuzeit (Arbeitsthema)
Thomas Vogel
